War Georges Bizet wirklich ein so genannter One-work-composer? Zugegeben: der „normale“ Opernfreund dürfte die Carmen – bekanntlich eine der besten und populärsten Opern aller Zeiten – kennen, sonst aber nie ein Stück des Franzosen auf einer Bühne erlebt haben. Dabei werden hier und da gelegentlich, wenn auch eher in konzertanten Aufführungen, Die Perlenfischer gespielt, sonst wenig mehr – aber wer neben den Perlenfischern eine Djamileh, eine Schauspielmusik zu L’Arlesienne, eine Jugendsymphonie, den Klavierzyklus Jeux d’Enfants und die darauf basierende Petite Suite hinterlassen hat, ist kein Ein-Werk-Komponist, sondern bekannter als manch anderer Meister, der lediglich durch eine Oper (beispielsweise La Juive) oder ein Konzert (beispielsweise ein Violinkonzert) im allgemeinen Gedächtnis der Musikfreunde hängen blieb. Bizet ist zweifellos bekannter als sein Schwiegervater Halévy oder als Max Bruch – und doch fristen immer noch einige seiner Stücke ein Dasein, das als Schattendasein zu bezeichnen übertrieben wäre. Wer kennt schon Vasco da Gama, Le Retour de Virginie oder Clovis et Clotilde? Immerhin handelt es sich bei diesen Jugendwerken um Miniatur-Opern, vulgo: Kantaten. Und da bei einem Meister (der Komponist der Carmen, der Arlesienne, der Jeux d’enfant und der C-Dur-Symphonie war ein Meister) Alles interessant ist, selbst das Fragment und das weniger Geglückte, was freilich immer im so genannten Auge, in diesem Fall: dem Ohr des Betrachters liegt, muss das Fehlen einer Bizet-Gesamtausgabe schwer bedauert werden.
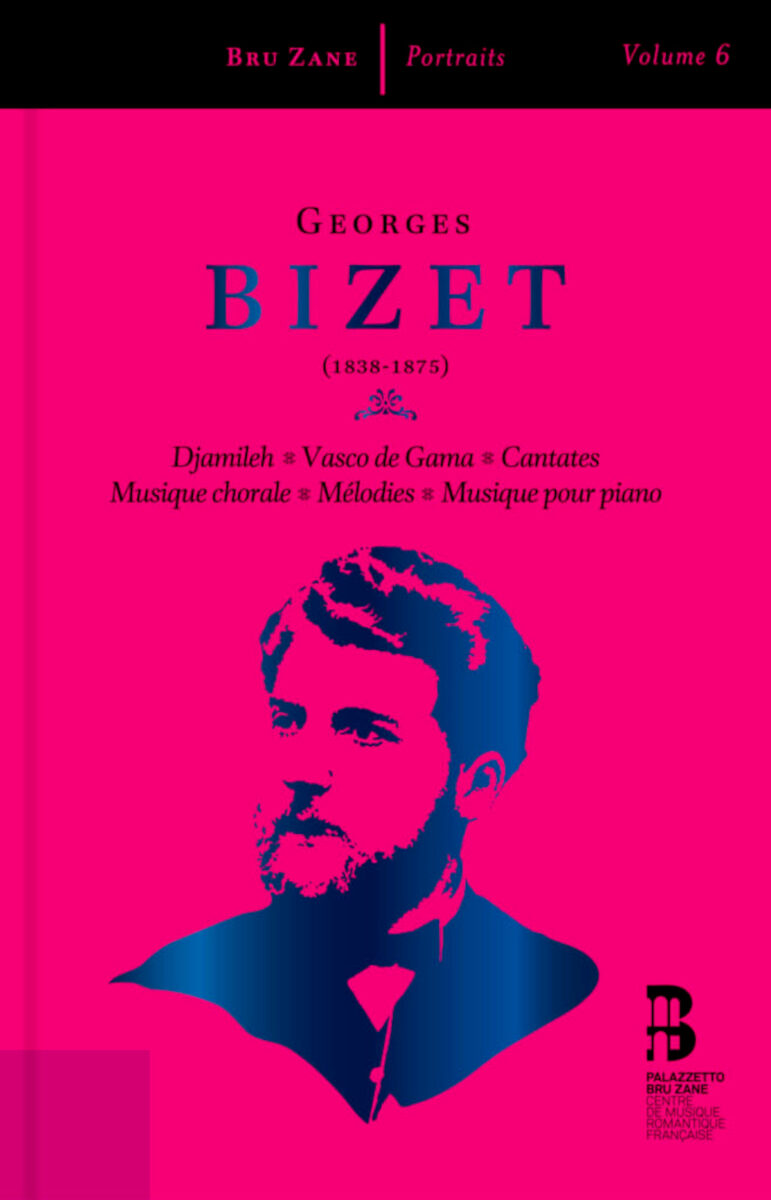
Keine Gesamtausgabe, aber immerhin eine Suite von vier CDs, eingelegt in die wie üblich mit seltenen Illustrationen, in diesem Fall den Titelseiten früher Notendrucke und Autographenfaksimiles wunderbar ausgestatteten und extrem gut informierten wie mit sämtlichen zweisprachigen Libretti versehenen Bücher der Palazzetto Bru Zane-Kollektion – die neue Edition erweitert nun also, pünktlich zur 150jährigen Wiederkehr des irdischen Verscheidens George Bizets, unser Wissen um den Komponisten in beträchtlicher Weise. Während von Clovis et Clotilde immerhin zwei Aufnahmen vorliegen, wurde aus Vasco da Gama bislang nur der Bolero eingespielt. La Retour de Virginie ist auf dem Plattenmarkt eine novité; nur Djamileh, mit der die Reihe prominent beginnt,hat bisher eine ausgiebige Zahl an Einspielungen erfahren. Kein Wunder angesichts der außerordentlichen Güte dieses Werks, das von wenigen Zeitgenossen, zumindest von wenigen Kritikern geschätzt wurde. Das Libretto, so Bizet, ist „ausgezeichnet, sehr edel, künstlerisch hochbedeutend; es wird mir ermöglichen, dass mich das Publikum nicht vergisst, und wird vielleicht gleichzeitig, wie ich hoffe, ein gutes Geschäft sein.“ Djamileh wurde kein Geschäft, auch war es nicht dieses 1872 uraufgeführte Werk, das den Namen des Komponisten unsterblich machte. Vielleicht ist es dafür ein zu feinsinniges, ein zu subtiles Stück, denn an künstlerischem Rang, an Originalität und dem, was die Franzosen esprit und charme nennen, mangelt es der Oper nun wirklich nicht. Im Gegenteil: sie enthält jene Musik, die sogar Winton Dean, den Verfasser einer grundlegenden, ausführlich würdigenden wie kritischen Bizet-Biographie, zur Bemerkung veranlasste, dass hier Musik zu finden sei, „die so überzeugend ist wie in keinem anderen Werk Bizets.“ Wie in keinem anderen Werk Bizets – tatsächlich ist die Djamileh ein feingeschliffenes Juwel. Auch Les pêcheurs de perles stehen im Schatten der Djamileh, wenn auch Ähnlichkeiten unüberhörbar sind.
Wieder steht, wie im Jolie fille de Perth, wie in Carmen, wie fast in den Perlenfischern und im Iwan IV., eine Frauenfigur im Mittelpunkt der Handlung, die schnell nacherzählt werden kann: Djamileh ist die augenblickliche Hauptsklavin des reichen ägyptischen Herren Haroun, der alle vier Wochen seine Frauen zu wechseln pflegt. Djamileh aber möchte sich mit diesem Schicksal nicht abfinden, weil sie ihren Herren liebt. Gemeinsam mit Splendiano, seinem alten Erzieher und Haushofmeister, ersinnt sie den Plan, sich als nächste Sklavin bei Haroun einzuschmuggeln. Verschleiert tritt sie zu ihm, und Haroun ist so entzückt, dass er ihr gesteht, dass er ihre Vorgängerin nur um seiner Freiheit willen verlassen habe. Als Djamileh auf dieses Geständnis hin zu weinen beginnt, lüftet Haroun den Schleier. Nun erkennt er Djamilehs Liebe, und seine wahren Gefühle erwachen.
Man kann es angesichts der äußeren Handlungsarmut und des unglaubwürdigen Schlusses fast schon verstehen, dass ein zeitgenössischer Rezensent die Bemerkung machte, dass es schon dramatisch wäre, wenn eine der Figuren wenigstens einmal einen Teller fallen lassen würde. Die Kritiken der üblichen Ignoranten waren teilweise haarsträubend: man entdeckte grelle Dissonanzen und üble Wagnerianismen, war schockiert von der angeblichen musikalischen Bizarrerie und verwarf den Opernakt – eine echte Opéra comique – als bloßen entr´acte. Die Gebildeten unter den Zuhörern, unter ihnen Saint-Saëns und Massenet, aber lobten das Kolorit und die Rolle des Orchesters, die zarte Atmosphäre, die Darstellung der Titelheldin. Sie behielten Recht, denn Djamileh lebt gerade durch diese Eigenschaften: die Instrumentation ist besonders sublim, die Melodik zeigt die besten Seiten des Melodikers Bizet, und die Atmosphäre atmet eine Leichtigkeit, unter der sich die psychologische Tiefe versteckt. Der Vorwurf des Wagnerianismus ist zwar verkehrt, aber ein möglicherweise unabsichtliches Zitat des Tristan-Akkords mag darauf hinweisen, dass Bizet den anderen Meister ironisch zitierte. Ansonsten ist das Werk denkbar unwagnerisch: gerade in der Chromatik, den Orientalismen und ihren mehrdeutigen Harmonien, die eine exotisch duftende Atmosphäre schaffen, die jedoch nicht Selbstzweck einer bunten Bühne bleibt. Bizet hat sich auch hier, indem er seine ganze Farbpalette einsetzte, vor allem für die inneren Konflikte interessiert. Seine Stimmung ist gleichwohl panorientalisch, nicht auf einen Ort fixiert. Scheinbar Indisches wird da mit Arabischem verwoben, fremdländische Rhythmen, die er schon in Iwan IV. einsetzte, stammen ursprünglich aus der symphonischen Ode Vasco da Gama. Sie werden dort mit Portugal assoziiert. Ein ägyptischer Tanz erfreut auch heute noch dieFreunde des französischen Tanzes. Wir hören am Anfang der Djamileh bei den Nilschiffern einen Chor, dessen Klangfärbung durch ein durchaus europäisches Instrument, ein Klavier, akzentuiert wird. Es hat selbst die konservativen Gemüter gestört, die doch eigentlich mit der Darstellung eines scheinbar heilen, fernen, märchenhaften Orients glücklich hätten sein müssen. Der Traum der Bühne nach der Realität eines 1871 verlorenen Krieges sollte auch später noch für Erfolge bei den französischen Komponisten sorgen.
Dekadent aber ist Djamileh und der in ihr gelöste Konflikt wohl nicht. Beim Librettisten Louis Gallet überwiegen die empfindsamen Aspekte, denen Bizet mit der Vollkommenheit seiner lyrischen Mittel beikam. Musikalisch ist Bizet das Finale allerdings nicht in dem Maß gelungen, das er mit den vorangegangenen Takten erfüllt hatte. Mit der Figur der Djamileh gelang ihm nämlich eine wunderbare Charakterzeichnung aus Stärke und Zärtlichkeit. So macht das Zusammenspiel von „Konversation, Atmosphäre und Musik“ (wie Christoph Schwandt in der Rowohlt-Monographie schrieb) Djamileh zu einem Werk, das, ginge es auf den Bühnen mit rechten Dingen zu, neben Carmen für den dauernden Erfolg des Musikdramatikers Georges Bizet sorgen müsste.
Es gibt also genügend Gründe, neben den zweifellos unbekannten Frühwerken auch das reife späte Werk des 34jährigen Genies von Neuem einzuspielen. Hier wie in ausnahmslos allen anderen Neuaufnahmen fallen die exzellenten Sängerinnen, Sänger und Orchester ein, die sich dem Projekt verschrieben haben. Man müsste sie pauschal loben. Isabelle Druet ist eine angenehm artikulierende Sopranschönheit, der man ihre ruhige Emphase und Verführungskraft glaubt, und Sahy Ratia ein luftig-kompetenter Tenor, wie geschaffen für die Partie des Serail-Libertins. Das Orchester Les Siècles spielt unter der Leitung von François-Xavier Roth alle Feinheiten der kostbaren Partitur heraus, deren Schönheiten von den Fernchören (der Choeur de l’opéra de Lille ist bei bester Stimme) über Djamilehs berühmtes Ghasel (ein betörender strophischer Gesang) bis zu tiefen lyrischen Bekenntnissen und federnden Rhythmen reichen.
Nur dem schärfsten Bizetianer dürfte dagegen Le Retour de Virginie bekannt sein. Die Ersteinspielung präsentiert die Kantate des 15- bis 19jährigen Schülers, der schon auf dem besten Wege war, ein Meister zu werden, nicht als Kuriosum, sondern als ernstzunehmendes Opus. Es war einmal so unbekannt, dass es von Winton Dean, der sich bei Bizet wirklich gut auskannte, nicht kommentiert wurde. Erstaunlich bleibt, wie sich der Jungkomponist des schwer „romantischen“, um nicht zu sagen: schwülstigen, also absolut zeitgeistigen Stoffs annahm. Die Geschichte Pauls, der als politischer Flüchtling auf der Île Bourbon lebt, wo er nichts Anderes zu tun zu haben scheint als seine Schwester Virginie zu erwarten und von seiner Mutter Marguerite getröstet zu werden, muss schließlich, nach einem Seesturm, zusammen mit dem von keines Gedankens Blässe angekränkelten Inselgeistlichen am Strand den toten Leib seiner Schwester erblicken – doch „Virginie est au ciel!“ Der Rest ist „Bumm“: ein affirmativ-dramatisches, wenn auch in Moll getauchtes Finale. Und trotz des zeitverhafteten Sentiments fasziniert die Stilübung von Jeune Georges, weil er schon als 18jähriger Frühreifer über die gehörigen technischen und melodischen Mittel verfügte, um aus der – von heute aus gesehen – altbackenen Geschichte ein Miniaturdrama machte: mit Harfenklang und orage, also einer veritablen Sturmmusik. Cyrille Dubois, Marie-Andrée Bouchard-Lesieur (in der stimmlich interessanten Zwischenpartie der Mutter) und Patrick Bolleire nehmen die Sache so ernst wie das klanglich wieder glänzend aufgenommene Orchestre national de Lyon, das unter Ben Glassberg den Komponisten mit Schwung und detaillierter Genauigkeit Ernst nimmt – so wie Bizet selbst die Aufgaben Ernst nahm, die ihm die Preisrichter des Prix de Rome stellten. Dass ihm die Ochsentour des fünf Jahre dauernden Arbeitsaufenthalts am Tiber nicht geschadet, sondern genützt hat, und dies nicht, weil, sondern obwohl er auf dem Weg zur Vollkommenheit war: all die Aufnahmen der „Nebenwerke“ machen den Zusammenhang glasklar.
Apropos Sturm: Auch in der Ode-symphonie Vasco da Gama musste, natürlich, einer vorkommen. Es ist erstaunlich, dass man dieses immerhin eine halbe Stunde dauerndes Werk von 1859/60 bislang übersehen hat, zeigt es doch einen Bizet am Werk, dem es innerhalb des zum Musikschauspiel mild tendierenden konzertanten Genres gelang, seine Eigenheiten als zur Oper strebender Komponist zu wahren. Die Ode-symphonie unterhält durch eine farbige Instrumentation (die Bizet offensichtlich schon sehr früh beherrschte), einen berühmt gewordenen wie bezaubernden Bolero eines von einem Koloratursopran gesungenen Matrosen namens Léonard und eine Lust am Ausmalen maritimer Szenen, die dem Werk bei den Kennern den Ruf eines „Oeuvre tout à fait cohérente“ verschafft haben, wie Alexandre Dratwicki im Buch schreibt. Dean war noch der Meinung, dass die Musik „auf weite Strecken hin sinnlos“ wirke; hört man die Aufnahme, kann man das Urteil kaum verstehen. Vielleicht muss man eine unauslöschliche Zuneigung zur französischen Muse des zweiten Kaiserreichs haben, in dem Halévy, Offenbach und Gounod ihre Triumphe feierten, indem sie, gelegentlich ausdrücklich bewusst, eine radikal antideutsche Ästhetik verfochten (ohne wie Bizet zu vergessen, dass auch Weber und Mendelssohn zu den Vorbildern gehörten). Wer Vasco da Gama unvoreingenommen hört, wird größtes Vergnügen an ihm haben, wenn auch mehr an der Musik als am Text des Librettisten Louis Delâtre, der dem Kolonialismus ungebändigt huldigt. Mélissa Pétit ist eine entzückend koloraturierender Léonard, Cyrille Dubois Vascos Bruder Alvar und Tomas Dolié ist in der erstaunlicherweise kleinen Titelrolle zu hören: alles auf sehr gutem Vokalniveau. Eine ungewöhnliche Besetzung besitzt die Rolle Adamastors, des sagenhaften Riesen: er wird von sechs Bässen, in diesem Fall des Flemish Radio Choirs, gesungen. Begleitet und grundiert wird die Kantate vom Orchestre national de Metz Grand Est unter der Leitung von David Reiland. das Christoph Schwandts Meinung, dass Bizet hier noch nicht auf der Höhe seines späteren totalen musikalischen Ausdrucks gewesen sei, nicht direkt widersprechen kann, aber doch Einiges relativiert. Es ist eben eines, ein Werk nur zu lesen oder aufzuführen und zu hören.
Clovis et Clotilde ist bei uns nicht ganz unbekannt, weil bereits zwei Aufnahmen vorliegen, die bekanntere aus dem Jahr 1988 mit Montserrat Caballe. Vergleicht man die Neueinspielung mit der gleichsam kanonischen, fällt auf, dass, bei einer vergleichbar mitreißenden Orchesterleistung, Karina Gauvin gegenüber ihrer älteren und berühmteren, damals jedoch schon am Ende ihrer erstklassigen Karriere stehenden Kollegin über das sicherere Stimmmaterial verfügt. Ihr Clovis, der blitzartig zum Christentum bekehrt wird, heißt Julien Dran, der Priester diesmal Huw Montague Rendall. Zusammen sind sie ein vokales Dreamteam, das dem typisch französischen Ton der auch religiösen Emphase des mittleren 19. Jahrhunderts, der nur nach Dean „farblos“ scheint, mit gut eingeteilter dramatischer Kraft und Lyrismus beikommt; wer den Text nicht versteht, weil sein Französisch nicht vorhanden oder eingerostet ist, versäumt nichts, wenn er den Text nicht versteht. Amédée Burion hat seinerzeit ein Beispiel des hyperromantischen Katholizismus geliefert, dem Bizets Musik immerhin dann einen Widerpart, der zugleich eine Entsprechung ist, liefert, wenn er 1857 seine Botschaft à la Verdi oder Gounod formuliert, was den Opernfreund besonders freuen müsste. Schon die Ouvertüre ist ja ein echter, schöner Bizet, und Clotildes Romance „Il est si beau“ ein wenn auch, nach Schwandts Urteil, „nicht originell(es)“, so doch wirkendes Stück, das den, pardon, dummen Text der gesamten, schwer opernhaften Kantate vergessen macht. Le Concert de la Loge scheint unter Julien Chauvin jedenfalls Spaß daran zu haben, auch diesen Bizet wiederzuentdecken.
Sinnigerweise folgt auf der CD No. III auf den Vasco da Gama, der übrigens zwei Jahre vor Meyerbeers Vasco da Gama (früher als L’Africaine bekannt) uraufgeführt wurde, ein Quartett von vier orchesterbegleiteten Chören. Dies ist ein Coup, denn der erste, Le Golfe de Baïa, wirkt wie eine direkte Fortsetzung des Vasco-Finales: ein Meerstück mit einem orientalisierend-einlullenden Grundrhythmus, Ausdruck des welligen Texts: „Vois-tu comme le flot paisible sur le rivage vient mourir?“ „Siehst du, wie die friedliche Flut am Ufer zum Sterben kommt?“ Auch diese vier Chöre sind Entdeckungen für den Feinschmecker, die die Stücke bisher nur in Werkkatalogen entdecken konnten. Weitere Stücke aus dem Salon, der so typisch ist für die französische Musikkultur der Epoche, also 15 Lieder auf Texte u.a. von Hugo, Ronsard u.a. (auch Wagner vertonte diese beiden Meister) und einige Klaviersachen, ergänzen, wie die Ersteinspielung einer 14 Minuten langen Ouvertüre in a-Moll, das reiche Programm. Dean hielt Adieux de l’hôtesse arabe für Bizets bestes Lied, doch auch die anderen sind nicht schlecht. Für den Opernfreund sind sie deshalb interessant, weil sich in manchen von ihnen Musik erhielt, die Bizet ursprünglich für seine unvollendet gebliebene Oper La coupe du Roi de Thulé notiert hat.
Hier wie dort, in Carmen und der betörenden Djamileh, aber schon in Clovis et Clotilde und sogar im juvenilen La retour de Virginie, entdeckt man, weil ein Meister eben vom Himmel zu fallen pflegt, wie der Münchner Musikschriftsteller Karl Schumann einmal anmerkte, den wahren Bizet – einen Bizet, den Nietzsche mit Recht gegen Wagner ausspielen konnte, weil er in ihm ein grundlegendes Element entdeckte: den Süden in der Musik. Den weithin unbekannten Bizet in „seinem“ Jahr in der Portrait-Reihe mit einigen extrem unbekannten und einigen raren Werken, mit sehr guten Sängern und Orchestern bekannter zu machen, weil Bizet eben doch kein One-Work-Composer war: es vermag zwar nicht damit zu versöhnen, dass zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2025 neben den seltenen Perlenfischern v.A. Carmen auf den Spielplänen der internationalen Opernhäuser steht (soviel zum „Ruhm“ der großen Meister). Doch könnte, ja müsste die Edition, wenn es einen Musikgott gäbe, wenigstens für die nachhaltige Kenntnis eines nicht nur bedeutenden, sondern auch besonders guten und unterhaltenden Komponisten sorgen.
Frank Piontek, 15. Mai 2025
Portrait Georges Bizet
Djamileh, Vasco de Gama, Le Retour de Virginie,
Clovis et Clotilde,
musique symphonique et chorale,
musique pour piano et mélodies
4 CDs
Label: Palazzetto Bru Zane
