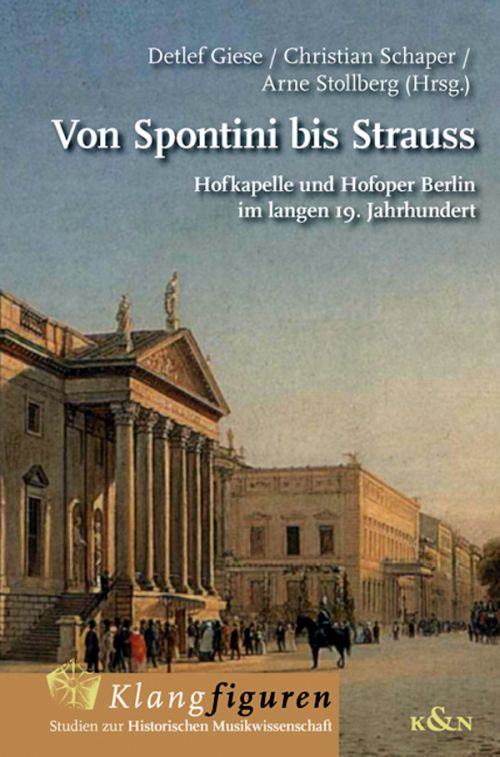
Die Staatsoper Unter den Linden ist vielleicht das Opernhaus, an dem sich, zumindest auf den ersten Blick, so wenig von der bewegten Bau- und Vernichtungsgeschichte ablesen lässt wie an keinem anderen deutschen Theatergebäude. Der Besucher, der auf die Fassade an Berlins altem Boulevard schaut, erhält immer noch einen Eindruck von der Architektur des Herrn Knobelsdorff, der dem Preußenkönig Friedrich II. ein repräsentatives Opernhaus in seine Residenzstadt stellte. Diverse Brände und ein Weltkrieg, dann ein Wiederaufbau unter gänzlich anderen politischen Bedingungen, haben dafür gesorgt, dass vom Ursprungsbau so gut wie kein Stein mehr vorhanden ist – die Staatsoper präsentiert sich heute, nach dem Wiederaufbau der 1950er Jahre, als ein (jahrelang) renoviertes und erneuertes Haus, in dem die einzelnen historischen Schichten wie Palimpseste übereinandergelegt sind, ohne ihm doch die Gestalt eines zeitvermischenden Artefakts zu geben.
Derartige Gedanken betreffs der Gleichzeitigkeit von Vergangenheit und Gegenwart mögen einem kommen, wenn man die einzelnen Beiträge liest, die, 2018 in einem Berliner Symposion vorgetragen, nun zu einem Sammelband vereinigt wurden, der sich auf das 19. Jahrhundert konzentriert. Im Sinn der französischen Geschichtswissenschaft haben wir es bei der Epoche zwischen der Französischen Revolution und dem Beginn des 1. Weltkriegs ein wenig mit einer „longue durée“ zu tun, in der sich die Geschichte der Institution „Hofoper“ und „-kapelle“ farbig erzählen lässt – das Berliner Haus macht da keine Ausnahme. Spannend ist ja schon die Frage, was überhaupt eine Hofoper ist (oder sein könnte); schon für die Zeitgenossen war das nicht ganz klar, wie es der Beitrag Michael Walters, dem wir einige profunde Bücher zur Geschichte der Oper als Institution verdanken, belegt. Dietrich Erben zeigt auf dem Gebiet der Architektur, die stets mehr ist als ein zufälliger Raum, wie sich ideologische Interessen und bauliche Strukturen und Veränderungen im Lauf der Zeit und immer von Neuem gekreuzt haben (Stichwort: Hofloge), bevor Ullrich Schneider die Programmpolitik des Hauses in Kontrast zu den Spielplänen anderer Berliner Musikbühnen beleuchtet: mit dem Fokus auf die Zeit um 1825, in der fast jeden Tag – und jeden Tag etwas Anderes, auch Triviales gespielt wurde. Man sieht: Spielplanpolitik ist, genau wie heute, eine knifflige Sache, die zwischen dem sog. Wahren, Guten und Schönen und der sybaritischen Vergnügungssucht größerer Teile des Publikums vermitteln muss, um an der Kasse keinen Schaden zu leiden. Die Frage, wer das alles an einer theoretisch vom Hof legitimierten und geleiteten Bühne zu zahlen hat, blieb stets so mehrdeutig wie der Begriff der Hofoper selbst.
Noch spannender wird es, wenn sich Fabian Kolb von neuem den Fall Spontini vornimmt. Anne Henrike Wasmuth konnte erst vor relativ kurzer Zeit in einer umfangreichem Buch („Musikgeschichte schreiben“) nachweisen, dass es weniger „rein künstlerische“ (als ob es das je gegeben hätte…) als nationalistische und politische Motive waren, die dem GMD und großen Komponisten das Leben an der Spree so schwer machten. Dass es bereits die durch den Dienstvertrag und den Aufgabenbereich des Intendanten verursachten Widersprüche waren, die dem französischen Italiener das Leben an der Preußischen Hofoper verleideten: dies wird von Kolb so genau herausgearbeitet, dass ein Schelm wäre, wer dabei an die noch heute gelegentlich ähnlich begegnenden Dissonanzen zwischen dem GMD und dem Intendanten an manchem Theater denken würde…
Widmet sich Merle Tjadina Fahrholz (Verfasserin einer guten Monographie von Marschners Der Templer und die Jüdin) in einer materialgesättigten Studie den Berliner Aufführungsgeschichten des Templers und des Hans Heiling, so hat es Ulrich Konrad mit Otto Nicolai zu tun, also mit den Jahren 1847 bis 1849 und der Heimkehr des Verbannten, einer jener vielen Opern, die immer noch, trotz gelegentlichster Ausgrabungen, auf ihre Rehabilitation in einem Randrepertoire warten. Musikgeschichtlich bedeutender scheint der Tiefenschnitt, den Anselm Gerhard vornimmt, wenn er, ausgehend von der sog. Wahnsinnsszene in Lucia di Lammermoor, faszinierende Spuren der sehr individuellen Klanggestalt(ung) v.a. bei Meyerbeer (im Feldlager in Schlesien) entdeckt, die von Friedrichs II. Flötenspiel begleitet werden. Gerhard erspürte, bis hin zu späten Manipulationen an Donizettis Partitur, „Echokammern, aus denen eine Klangchiffre für die Dissoziation des hysterischen weiblichen Ichs entwickelt“ wurden.
Die (Aufführungs-)Geschichten, die Richard Wagner mit der Berliner Hofoper verbanden, waren sicher dissoziierend. Arne Stollberg erläutert Wagners Versuche, an der Spree zu reüssieren; er nennt‘s: „Expeditionen“, was den Berliner Fall Wagner treffender beschreibt als der Versuch, angesichts der Berliner Widerstände eine normale Aufführungshistorie nachzuzeichnen. Hintersinnig aber ist die Pointe: vielleicht, so Stollberg hypothetisch, war es eine kritische Einschätzung des Rienzi durch den Berliner Rezensenten Ernst Kossack, die Wagner (auch) dazu brachte, einen neuen ästhetischen Weg einzuschlagen. Was bei Wagner hängenblieb, war ein antisemitischer Affekt, mit dem er, retrospektiv, sich sein Berliner Scheitern gegen Meyerbeer zu erklären suchte, womit Das Judenthum in der Musik über den allgemeinen bekannten Meyerbeer-Komplex hinaus seinen historischen Ort auch in Berlin finden würde. Spannend ist bereits die Vermutung, dass die „Dornenhecken“ in den Meistersingern eine Anspielung auf Heinrich Dorn sein könnte. Wer dies zu gewagt findet, sollte bedenken, dass man bei Wagner, trotz aller skrupulösen Philologie, ja oft nicht so ganz genau weiß, wo er etwas her hat.
Thomas Seedorf, eminenter Stimmen-Kenner, erläutert in einem eigenen Beitrag, wer alles in Berlin die Opern und Musikdramen bis zum Tristan erstaufführte: ein probater Versuch, sich an verlorene Stimmen heranzuarbeiten, die kein Tondokument mehr bewahrt. Bleiben mehrere Beiträge zur Hofkapelle, die – im 19. Jahrhundert unter Wilhelm Tappert relativ konservativ verfahrend – lange brauchte, um sich die Moderne zu erobern, als Richard Strauss den Taktstock übernahm, womit allerdings keine wirkliche Revolution verbunden war: Beethoven blieb, vor Strauss und Mozart, der meistgespielte Komponist der beiden Zeitalter, in denen die Engagementsgeschichte eines Felix Weingartner wesentlich spannender war als manch symphonisches Programm (nachzulesen bei Christian Schaper, der auch die luziden, auf Wilhelm II. gemünzten Anmerkungen des Intendanten Georg von Hülsen zur projektierten Salome in toto abdruckt: ein Schmankerl das). Was bleibt, sind einige Aufnahmen des symphonischen, aber auch des Opern-Repertoires, die, etwa unter Strauss und Leo Blech, bis zum Ende des Kaiserreichs mit der Königlichen Kapelle hergestellt wurden und bislang, so Johannes Gebauer, in ihrem historischen Wert unterschätzt worden sind.
Danach ist man bekanntlich immer klüger. Dies gilt auch für die Einsicht, dass es sich lohnen würde, im Netz nach den Uralt-Aufnahmen zu suchen, die uns die Geisterstimmen der Vergangenheit ins Ohr senden könnten. Dabei würde schon die Einspielung des Karfreitagszaubers unter Leo Blech sehr schön zeigen, wie heutig die Kapelle schon damals klang: https://www.youtube.com/watch?v=8ac3M5hIhU8.
Wie gesagt: In der ehemaligen Berliner Hofoper verschränken sich Geschichte und Gegenwart auf manchmal sehr nahe Weise.
Frank Piontek 7. Dezember 2022
Detlef Giese, Christian Schaper, Arne Stollberg (Hrsg.)
„Von Spontini bis Strauss. Hofkapelle und Hofoper Berlin im langen 19. Jahrhundert.“
Königshausen & Neumann. 2022. 339 Seiten.
ISBN 978-3-8260-7219-2
