Nach umjubelten Aufführungen in Prag und Paris erlebte Wagners Siegfried ebenfalls eine denkwürdige Premiere in der nicht ganz ausverkauften Kölner Philharmonie. Im Rahmen eines mehrjährigen Projekts mit dem Namen „The Wagner Cycles“ präsentierte Dirigent Kent Nagano mit dem Dresdner Festspielorchester und dem Ensemble Concerto Köln nach Rheingold und Walküre nun auch Siegfried in einer historisch informierten Aufführungs-praxis. Die Frucht des auf zehn Jahre angelegten Forschungsprojekts „The Wagners Cycles“ , so führte Kent Nagano in einem Interview vor der Siegfried-Premiere in der Staatsoper in Prag selbst aus, sind nicht nur fünf Bücher, sondern vor allem Aufführungen des Ring des Nibelungen in einer Form, die nach Überzeugung Naganos und des gesamten Forschungs-teams Wagner selbst für ästhetisch ideal hielt. Es sei das Ziel gewesen, sich dem anzunähern, was Wagner selbst über die Stimmen und ihren Gesangspart sowie über Klang und Spielweise des Orchesters gedacht habe.
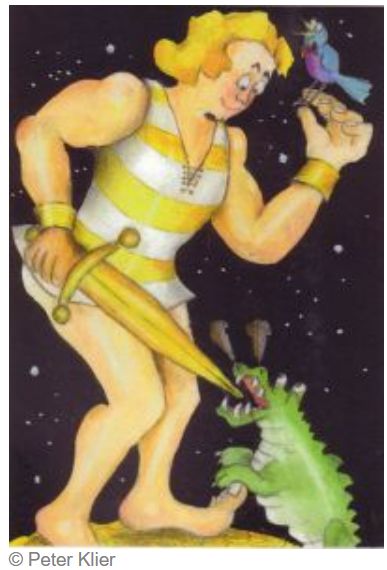
Eine wesentliche Rolle spielt dabei, dass auch bei den Instrumenten der Rückgriff auf die Entstehungszeit konsequent umgesetzt wird. So spielen die Streichinstrumente auf Darmsaiten und die Blasinstrumente wurden im Sinne der historischen Vorbilder neu konstruiert. In seinem Interview erläutert Kent Nagano die dadurch erzielte Wirkung am Beispiel der eigens für den Siegfried nachgebauten Kontrabasstuba, durch welche die berühmten Fafner-Motive des ersten Aktes einen ganz neuen Klang erhalten hätten. Ganz allgemein darf man wie schon beim Rheingold und der Walküre auch bei der Aufführung des Siegfried konstatieren, dass das Klangbild des Orchesters transparent und „durchsichtig“ erscheint, sodass auch die Sängerinnen und Sänger dem Anspruch Wagners gerecht werden können, passagenweise sich eher eines deklamierenden, rezitationsartigen Sprechgesangs zu bedienen.
In seinem Beitrag im Programmheft führt Dominik Frank aus, dass es bei den Nachforschungen zu Siegfried im Vorfeld aber vor allem auch darum gegangen sei, das Werk aus seinem historischen, gesellschaftlichen und politischen Umfeld heraus zu verstehen. Und hier, so Frank, komme man an dem verstörenden werkimmanenten Antisemitismus in Siegfried nicht vorbei. Visuell, aber eben auch akustisch in der Art des Sprechgesangs mit sehr vielen Vorschlagnoten werde Mime in diffamierender Weise mit antisemitischen Stereotypen belegt. Man habe sich entschieden, diese beklemmende Seite des Siegfried nicht zu ignorieren, sondern z. B. bei der musikalischen Gestaltung der Partie ganz bewusst zu verdeutlichen.
Im dritten Teil von Wagners Tetralogie Der Ring des Nibelungen begegnen in Anlehnung an das mittelalterliche Nibelungenlied verstärkt märchenhafte Elemente. Tatsächlich wollte Wagner ursprünglich eine Märchenoper in Anlehnung an Grimm über eine Märchenfigur schreiben, die auszog, das Fürchten zu lernen. Dieser Motivkomplex wird nun in Siegfried mit dem Mythos verbunden. Der ehemalige Goldschmied Mime, dem die sterbende Sieglinde ihren Sohn anvertraut, vermag die von Sieglinde erhaltenen Splitter von Siegmunds zerbrochenem Schwert Nothung nicht zusammenzufügen. Von dem Wanderer erfährt er in der Wissenswette des ersten Aktes die Antwort: „Nur wer das Fürchten nie erfuhr, schmiedet Nothung neu!“ Es ist der junge Held, der Spross aus der Liebe des Zwillingpaares Siegmund und Sieglinde, der das Fürchten nicht kennt, das Schwert Nothung schmiedet und in diesem psychoanalytisch überfrachteten Coming-of Age-Stück auszieht, ihm auferlegte Prüfungen zu bestehen und das Fürchten zu lernen. Das Fürchten stellt sich ihm weder im Kampf mit dem Lindwurm Fafner noch in der Begegnung mit Wotan ein, sondern es ist die Erfahrung der Liebe zu der aus ewigem Schlaf durch ihn wach geküssten Brünhilde, die Siegfried schließlich das Fürchten lehrt.
Dass Siegfried bei seinem Weg des Erwachsenwerdens auch einen dreifachen Vatermord – Mime, Fafner und indirekt auch Wotan – begeht, gehört zum Genre eines an Shakespeare gemahnenden Actionstücks. „Der Anarchist Siegfried, treuherzig und flegelhaft, würde die alte, von ihm selbst geschaffene, von ihm aber auch korrumpierte – Ordnung aus den Angeln heben und ein neues, freies Menschenzeitalter begründen. Wotan selbst … wünscht sich dieses Ende seiner Geschichte“ (so Oliver Binder im Programmheft). Siegfried wird so zu einer großen Weltentsagungstragödie.
Viel ist darüber gerätselt und geschrieben worden, warum Wagner 1857 die Arbeit an seiner Oper mit dem unvollendeten zweiten Akt für zwölf Jahre ruhen ließ. Waren es die Diskrepanzen zwischen den märchenhaften Motiven und den mythologischen Elementen, die Wagner spürte? Immer wieder hat man darauf hingewiesen, dass der Gegensatz zwischen der Waldvogelszene im zweiten Akt mit ihrer an Weber gemahnenden romantischen Waldeinsamkeit und der tragisch-pathetischen Beschwörung Erdas zu Beginn des dritten Aktes einen scharfen Kontrast darstelle, dass diese Gegensätzlichkeit musikalisch von Wagner schließlich dank der partiellen Übereinstimmung in der Leitmotivik gemeistert worden sei. Wie dem auch sei, in Siegfried gelangt Wagner in der musikalischen Umsetzung der Naturbilder und der plastischen Charakterisierung dramatischer Handlungsmomente zu einer neuen Meisterschaft.
Musikalisch wird dieser unvergessliche Abend in der Philharmonie noch lange in Erinnerung bleiben. Die Leistung der Musikerinnen und Musiker des Dresdner Festspielorchester und des Ensemble Concerto Köln unter der mirakulösen Leitung Kent Naganos muss dabei besonders gewürdigt werden. Vor allem die Klangschönheit der Streicher, aber auch die Präzision, Farbenvielfalt und Durchschlagskraft der Bläser riss das Publikum zu geradezu orkanartigen Beifallsstürmen hin. Auch das Sängerensemble ließ kaum Wünsche offen. Das gilt vor allem für den australischen Bassbariton Derek Welton, der mit seinem wunderbar warm timbrierten, in allen Lagen kraftvollen und ausdrucksstarken Bariton die zerrissene Figur des Wanderers großartig gestaltete. Als Einziger verzichtete Derek Welton auf den stützenden Blick in die Partitur, wodurch er auch in der Lage war, die unterschiedlichen Stimmungen seiner Figur schauspielerisch ergreifend darzustellen.
Der belgische Tenor Thomas Blondelle schlug sich in der mörderischen Partie des Siegfried mehr als achtbar. Nach eher verhaltenem Beginn im ersten Akt – vor allem beim Schmiedelied- steigerte sich Blondelle vor allem in den lyrischen Passagen des 2. Aktes (Waldweben), aber auch in den dramatischen Dialogen mit Mime im zweiten und dem Wanderer im 3. Akt, schließlich im großen Schlussduett mit Brünnhilde zu einer eindrucksvollen Leistung. Nun erreichte die Stimme jene jugendliche Strahlkraft, die man mit der Siegfriedfigur verbindet. In eher gammeligem Outfit spielte Blondelle den unbekümmerten Himmelsstürmer zudem ganz ausgezeichnet.
Christian Elsner verlieh mit seinem Charaktertenor der Figur des Mime die nötige Boshaftigkeit und Perversität und schuf damit ein stimmiges Rollenportrait. Daniel Schmutzhard ist als Alberich eine Idealbesetzung. In Gesang und Spiel verleiht er der Figur eine eindringlich düstere Prägnanz. Hanno Müller-Brachmann dröhnt mit Hilfe eines riesigen Megaphonkegels zunächst ganz furchterregend, bevor er dann in der Sterbeszene beinahe lyrische Töne anstimmt. Kammersängerin Ulrike Schneider übernahm für dieerkrankte Gerhild Romberger die Rolle der Erda. Fehlt ihrem Mezzo für die Erdenmutter vielleicht auch ein wenig die Tiefe, so fügte sie sich dennoch mit guter Deklamation in das vorzügliche Sängerensemble ein.
Die schwedische Sopranistin Asa Jäger ist vielleicht jetzt schon trotz ihrer jugendlichen Jahre eine der ganz großen Brünnhilden unserer Tage und steht damit in der Tradition so großer Interpretinnen wie Birgit Nilsson oder Nina Stemme. Ihr Schlussduett mit Siegfried wird dank ihres leuchtenden, in den Höhenlagen geradezu triumphierenden Gesangs zu einem der ganz großen Höhepunkte dieses denkwürdigen Abends. Die Stimme des Waldvogels lag in den kleinen Händen eines Knabensoprans des Tölzer Knabenchores. Der namentlich leider nicht aufgeführte Tölzer Sängerknabe machte seine Sache ganz ausgezeichnete und spielte den putzigen Waldvogel ganz allerliebst.
Das Publikum feierte alle Beteiligten mit lang anhaltendem, enthusiastischem Beifall. Schon jetzt darf man sich auf die Götterdämmerung im Jahr 2026 freuen, die dann den triumphalen Abschluss eines Rings des Nibelungen bilden wird, der wohl für viele Jahre in allen Belangen neue Maßstäbe setzt.
Norbert Pabelick, 11. April 2024
Leider keine Originalbilder!
Siegfried
Richard Wagner
Philharmonie Köln
Premiere am 10. April 2025
Musikalische Leitung: Kent Nagano
Concerto Köln/Dresdner Festspielorchester
