„Diese beharrlichen und zugleich flüchtigen Themen, die in einem Akt anklingen, sich entfernen, um zurückzukehren, und, manchmal weit entfernt, abklingend, fast losgelöst, in anderen Augenblicken, auch wenn sie nur angedeutet bleiben, so eindringlich und nah, so innerlich, so organisch, so körperlich zu spüren sind.“ Man kann das Programm des monumentalen Buchs, das schon schnell in deutscher Übersetzung vorlag, nicht besser charakterisieren als durch ein Zitat, das der Autor Marcel Prousts „La prisonnière“, einem Band aus dem Zyklus der „Recherche du temps perdu“, entnahm. Man könnte es auch kürzer ausdrücken: wie „die emotionale Wirkung einer Kunst mit den Mitteln einer anderen Kunst wiedergegeben“ wird – und auch dieses Zitat, diesmal aus Willa Cathers Anmerkungen zu Gertrude Halls „The Wagnerian Romances“, findet sich in Alex Ross‘ „Die Welt nach Wagner. Ein deutscher Künstler und sein Einfluss auf die Moderne“.
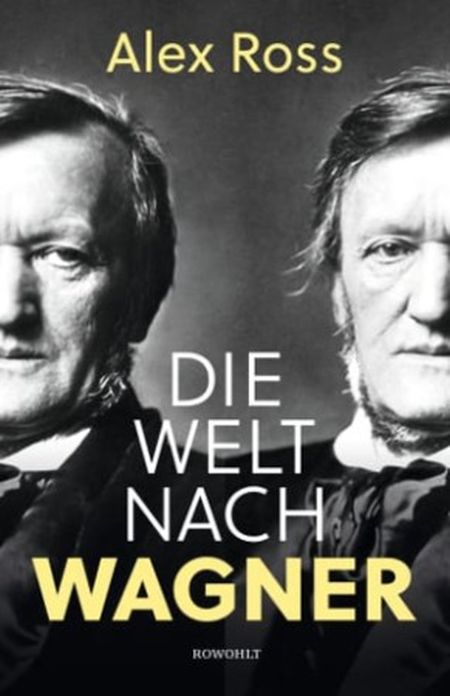
Der englische Untertitel lautet etwas anders – und präziser: „Wagnerism. Art and Politics in the Shadow of Music.“ Die These lautet also: „Wagner hat maßgeblich das bürgerliche Jahrhundert geprägt, von der Blütezeit bis zum verhängnisvollen Niedergang“, und dies, man weiß es, weil er nicht allein ein Musiker, sondern auch ein Ideologe und Autor war, dessen Schriften und Musikdramen weit über den Tellerrand der Opernwelt hinaus wirkten. Dass Ross die Wirkung(en) Wagners auf die Kunst und die Politik, die sich bisweilen meist unheilvoll annäherten, aber nicht auf dem Gebiet von Wagners eigentlicher Kunst: der Musik verfolgt, hat Gründe, denn dieser Einfluss ist – selbst dort, wo er ohrenscheinlich anklingt – viel weniger nachweisbar als auf dem Terrain von Bildender Kunst, Literatur, Theater, Philosophie, Film – und eben Politik. Wer indes vermutet, dass sich der politische Wagner allein im Besitz der Rechten befindet, irrt; Ross‘ Buch, das sich an die sog. Kenner wie die neugierigen Novizen richtet, ist gerade dort stark, wo die linken und anarchischen Wege des linksradikalen Wagnerismus beschritten werden. Kein Wunder also, dass diese „Geschichte missglückter Analogien“, wie der Autor selbst sein Themengebiet beschreibt, das er sodann auf 750 Seiten höchst materialreich betritt, nicht irgendeinen „wahren Wagner“, sondern die verschiedensten Wagner-Abbilder beschreibt: denn er wirkte zu wesentlichen Teilen durch Transformationen (wie in Mallarmés Sprachmusik), nicht allein durch Adaptionen. Verlief die Rezeption zwischen „Lobhudelei und Verachtung“, Anbetung und scharfer Kritik, so erscheint Wagners Werk, um ein Wort Sigmund Freuds (der natürlich auch seinen Auftritt hat) abzuwandeln, als polymorph perverser Katalysator von Interpretationen, die sich oft ausschließen. Das ist nicht neu – aber auf so breiter Basis wurde die These noch nie bewiesen. Nebenbei: Man bekommt Lust, sich das ganze Originalmaterial ins Haus zu holen, um die Romane, Erzählungen und Analysen zu lesen, die Bilder und die Filme sich anzuschauen. Ross kennt sich übrigens nicht nur in der englischsprachigen, auch in der deutschen Literatur gut aus; das bezeugen die gut 100 kleingedruckten Seiten mit den präzise Nachweisen. Er bietet sichtlich mehr als die Spitze eines Eisbergs, ja: er steigt mit uns auf ein gewaltiges Massiv, lässt uns jedoch nicht mit den vielen Persönlichkeiten am Wegesrand allein. „Die Welt nach Wagner“ ist gerade für jene Wagnerianer geeignet, die meinen, dass sie „schon alles“ über Wagners Wirkungen wüssten. Und Ross beglaubigt in seinem Nachwort die Relevanz seiner Einschätzungen, in dem er die Authentizität durch seine autobiographischen Erfahrungen vermittelt, also durch eine Subjektivität, wie sie dem Gegenstand allein gerecht wird.
„Wagner resümirt die Modernität“, wie Nietzsche schon sagte. Nietzsche ist denn auch der Ariadnefaden im Labyrinth des Wagnerismus, weil er die (notorisch umstrittene) Grundlage der modernen Wagnerkritik schuf, die zugleich affirmativ ist, vielleicht sein muss. Schon schnell wird klar, dass Ross – nicht nur ein ausgewiesener Musiktheoretiker, sondern auch ein -praktiker – ein Meister darin ist, musikalische Techniken wie das Leitmotiv und harmonische Sequenzen mit kulturgeschichtlichen Beobachtungen zu verbinden. Das Tristan-Vorspiel ist ein Hauptwerk der „décadence“? Ross belegt es, mit genauen Zitaten nicht nur von Baudelaire. Immer wieder überrascht Ross durch wahre Trouvaillen: Wer weiß schon, dass Fergus Hume kurz nach Wagners Tod ein Sonett verfasste, in dem er von „Aeschylean Music“ sprach? Wer kennt schon das Echo von Wagners „Freischütz“-Artikel in George Sands Novelle „Mouny-Robin“? Und wer ist sich darüber bewusst, dass Wagners Rezeption manchmal auf Wagner zurückwirkte: wie im Fall der von Wagner inspirierten Waldmetaphorik, die über Baudelaire und Champfleury den „Siegfried“-Komponisten selbst inspirierte? Auch so konnte die „subjektive Wiederaneignung“ (Lacoue-Labarthe) aussehen, die Ross bei Gerard de Nerval und dessen „Aurelie“ mit ihren Walküren entdeckte. Wen wundert es, dass, nachdem Ducasse, Champfleury, Zola und Verlaine sich an Wagner abgearbeitet hatten, nicht nur Wagner, sondern auch die Wagnerianer schon früh parodiert wurden?
Zweifellos ist die englische Wagner-Rezeption einem deutschsprachige Publikum weniger vertraut als die französische und die belgische. Sie hat durch Ross ihren Biographen gefunden, der die ganz andere Art und Weise beschreibt, wie Wagner, dieser „Leckerbissen“ (Queen Victoria), vor dem Hintergrund des King-Arthur-Kults von den Briten begriffen wurde. Doch auch hier entfernt sich der feinnervige Ästhetizismus des viktorianischen Zeitalters von den mythischen Ursprüngen. Mythos und Moderne trennten sich spätestens dort, wo Darwins „On the Origin of Species“, Marx‘ „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ und „Tristan und Isolde“ zu verblüffend analogen Signaturen des Zeitalters wurden: im Sinne einer Aufklärung, die in Wagner die Moderne am Werk sah, während George Eliot mit „Middlemarch“ und dem „Daniel Deronda“ pur wagnerische Romane schuf. Zwischen dem französischen und englischen Ästhetizismus war der Unterschied allerdings so groß wie der zwischen dem russischen Symbolismus und der deutschen Tümelei, so dass ein deutsch-österreichischer Wagnerverein alles mögliche, nur nicht musikalisch oder im strengen Sinne wagnerisch orientiert sein konnte. Aber was heißt schon: „in strengem Sinn“, wenn Wagner in den subkutansten Schichten zu wirken vermochte.
Ebenso unbekannt dürfte dem, der an den seltsamen Wegen der Wagnerwirkung interessiert ist, die US-amerikanische Aufnahme des Dichterkomponisten in das ästhetisch-ideologische Pantheon sein. Pinckney Marcius-Simons war, um ein prägnantes Beispiel zu nennen, das weniger abseitig ist als es zunächst scheint, ein in Bayreuth lebender Maler, für den sich im 20. Jahrhundert Jackson Pollock interessierte. Nicht allein bei George Bernard Shaw, dessen „Perfecte Wagnerite“ zu den bekanntesten Zeugnissen einer entwickelten britischen Wagner-Idolatrie gehört, begegnet, etwa bei Sidney Lancier (so wie bei Fontane), die Deutung Wagners durch die Brille der modernen Gegenwart. Es mag beruhigend sein, zu erfahren, dass der rechte Wagner kein deutsches Privileg war und ist. Er war auch der „mentale Soundtrack“ für rassistische Cowboy-Phantasien, wie sie in D.W. Griffitths reaktionärem Filmmeisterwerk „The Birth of a Nation“ von Neuem erscheinen werden. Man sieht: Besonders spannend wird das Buch dort, wo der „gemeine“ Wagnerianer Türen geöffnet bekommt, von denen er bislang nicht einmal ahnte, dass sie existieren. Stichwort „Tür“: in der Architektur planten John Wellborn Root und Louis Sullivan so etwas wie wagnerianische Bauten: „Sullivan wollte das amerikanische Bankenwesen in ein angenehmes Licht tauchen, als ob in den Tresoren unberührtes Rheingold schimmerte.“
Dies nur als Beleg dafür, dass Ross immer wieder zu brillanten Pointen findet (wie die, dass Brünnhilde, musikentstehungsgeschichtlich betrachtet, Wotan zeugte und nicht umgekehrt), die ihren Teil dazu beitragen, das uferlos scheinende Material so wie die starken Interferenzen zwischen einzelnen Kapiteln thesenhaft zu strukturieren. Wenn die Hauptfigur in Willa Cathers „A Wagner Matinée“ mit der in sich gekehrten Mutter in Fernand Khnopffs symbolistischem Gemälde „En écoutant du Schumann“ verglichen wird, begreifen wir, dass der Beziehungszauber nicht nur in, sondern auch außerhalb des Wagnerschen Gesamtkunstwerks zu wirken vermochte – eines Gesamtkunstwerks, das mal mehr, mal weniger adaptiert und abgelehnt wurde. So ist „Die Welt nach Wagner“ Schatzkammer und Pandämonium in einem, bis unter die Decke angefüllt mit Kunst und Kitsch (was bisweilen kaum unterscheidbar ist), doch gleichzeitig stringent konzipiert. Den Begriff des „Pandämonium“ verwendet Ross übrigens selbst, und zwar genau dort, wo er die Unterscheidung zwischen Wagners Werk und seinen Folgen mit einem Wort Roland Barthes‘ belegt, demzufolge „die Einheit eines Textes nicht im Ursprung, sondern in seinem Zielpunkt liegt“. Die sei, so der kritische Monograph, eine Schlussfolgerung, die sich ganz natürlich aus dem „interpretatorisches Pandämonium des Wagnerismus“ ergebe. Auch aus diesem Grund ist es uns ja heute unmöglich, die Werke so zu sehen und zu inszenieren, „wie Wagner es sich vorstellte“.
Und also lernen wir endlich den irischen Wagnersopranroman „Evelyn Innes“ (1898) von George Moore kennen. Wir besteigen mit Marcel Batilliats „Chair mystique“ einen frühen Gipfel des perversen Wagnerismus, dem mit Lina Wertmüllers Film „Pasqualino Settebelezze“ ein später (von 1975), unter dem Schatten der NS-Diktatur stehender folgt. Immer wieder bemerken wir mit Ross, dass man – wie Stefan George und James Joyce – durch Wagner hindurch muss, um ihn zu überwinden und ein neues Kunstwerk zu schaffen, das gleichzeitig, siehe „Ulysses“, siehe „Finnegans Wake“, mit Wagnerzitaten und -techniken vollgestopft ist und sich trotzdem vom „Meister“ emanzipiert hat. Mit Joyces Zeitgenossen Gabriele d’Annunzio beschwört Ross die politischen Gefahren des (dekadenten) Wagnerismus, doch mit dem „doppelten Bewusstsein“, das bei einigen schwarzen und jüdischen Wagnerbewunderern herrschte, gleichzeitig die ambivalenten Wirkungen auf ausgewählte Außenseiter. Gerade der Blick auf Wagner und die Schwarzen – ein Thema, das dem durchschnittlichen europäischen Wagnerianer fremd sein dürfte – und den Afro-Wagnerism könnte uns davor bewahren, im Wagnerismus ein lokal und zugleich zeitlich begrenztes Phänomen zu sehen. Dass Wagner auf ungeahnte Resonanzflächen, selbst und gerade bei vielen Juden, stieß und immer noch stößt, muss nicht verwundern – doch dass mit Luranah Aldridge im Jahre 1893, während die „Judenfeindschaft gewöhnlich nicht zu Wagners charakteristischen Eigenschaften gezählt“ wurde, eine erste schwarze Walküre auf der Bayreuther Festspielbühne stand, ist einer jener wunderbaren Funde, um derentwillen es sich schon lohnt, das Buch zu lesen. Wird um 1900 der Wagnerismus und gleichzeitig der Anti-Wagnerismus, der – das ist nur scheinbar widersprüchlich – von ihm abhängt, immer komplexer, so wundert es den Leser nicht, mehr wagnerisch inspirierte Tode in Venedig als bei Thomas Mann zu entdecken. Wir treffen folgerichtigerweise auf den Wagner der Schwulen und der Psychoanalytiker, der Lesben und der Linken. Wir bekommen eine ausführliche Analyse von Willa Cathers „The song of the lark“ („Unter den bedeutenderen Autoren war Thomas Mann der einzige, der mehr über Wagner wusste, aber er kannte sich nicht so gut mit Sängern aus“), von Virginia Woolfs „The waves“ (in dem der Stream of consciousness, also Tristans unendliche Melodie ein Stilprinzip ist) und von Joyces „Ulysses“ (eine großartige Umdeutung und fröhliche Burleske“) geschenkt, erblicken den Fliegenden Holländer in Stephen Dedalus und die möglicherweise kaum zufällige Analogie von Leopold Bloom und dem Blühen (blüht = Bloom) des Karfreitagszaubers. Ist Joyces Werk ein Opus der Apophrades (wie der Literaturhistoriker Harold Bloom die Haltung der Akzeptanz eines vorher unterdrückten Vorläufers bei gleichzeitigem Überlegenheitsgefühl nennt), so ist T.S. Eliots Wagner anti-wagnerianisch, ohne in „The Waste Land“ den „Parsifal“ und den „Tristan“ vergessen zu machen. Wagner konnte Vor- und Feindbild sein, manchmal sogar gleichzeitig. Verwirrenderweise waren die Futuristen gegen und für Wagner – selbst Marinetti, der auf Wagner spuckte, war Wagner in seinem revolutionären Furor verpflichtet: „Sogar wenn sie Wagner’sche Kultur bekämpften, folgten sie einem Wagner’schen Regiebuch“ – nämlich dem des Agitators von 1849. Es mag sein, dass der Erste Weltkrieg das Ende des Wagnerismus als intellektuelles Phänomen markierte – als künstlerisch wirksames Phänomen hatte er noch lange nicht ausgespielt: wie Appia, Fortuny, Kandinsky, die Bildenden Künste und die Bühnen nach 1900 belegen, unter denen die Reformbühnen und die Kroll-Oper der späten Weimarer Republik herausragen. Es mag sein, dass Assoziationen eines „unsichtbaren Theaters“, das Ross in den esoterischen Zeichnungen einer Hilma af Klint entdeckt, weit hergeholt scheinen – dass sie im Umkreis von Wagnerianern entstanden, sollte zu denken geben: so wie der Einsatz der Leitmotivtechnik, ohne den Prousts monumentaler Siebenteiler anders aussehen würde und Antoni Gaudí seine extravaganten Bauprojekte, bis hin zur geplanten, parsifalesken Kuppel der Sagrada Família und dem Palau Güell, nicht entworfen hätte.
Nein, Wagner-Interpretationen waren nicht „richtig“ oder „falsch“, sie waren und sind angesichts seines maßlosen und uneinheitlichen Deutungsangebots nur zu verständlich. Im Wagner der Linken und der Rechten, bei Lassalle, Bebel, Zetkin und Jaurès, bei Hitler, dem späten Dalí, den White Supremacists (Alain de Benoist) und Heidegger konnte der Dämon Wagner sehr bequem seine Masken wechseln. Denn „es wäre falsch zu behaupten, dass Shaw und seine linken Gefährten den ‚wahren‘ Wagner gefunden hätten. Aber es wäre ebenso falsch, zu behaupten, dass sie ihn missverstanden hätten.“ So gab es nur scheinbar erstaunliche Allianzen zwischen Kunst und Politik: die Bolschewiken und die Nazis konnten Wagner gleichermaßen interpretieren, während deutschnationale und perverse Ästheten den Zauberer von Bayreuth vergötterten. Hier also Wladimir Tatlins berühmter Turm, der ursprünglich der Mast des Holländerschiffs war, der russische Wagner des Futurismus und des Regietheaters, dort der Wagner von Walt Disney, Adorno und Thomas Mann. Dass Hans Castorp und Willa Cathers Claude Wheeler in „One of ours“ verwandt sind, ist nach allem, was man bisher las, nur selbstverständlich – und dass Hitlers Wagner nicht der Wagner der NS-Zeit war: auch dies sollte sich, nach den Untersuchungen zur Musikkultur des Dritten Reichs, inzwischen auch unter Wagnergegnern herumgesprochen haben.
Ross‘ Werk ist auch deshalb ein Werk der Aufklärung, weil die kulturhistorischen Funde und Analysen nicht umstandslos als herausragende Einzeltaten gedeutet werden und berühmt-berüchtigte Einsätze nicht als „Begleitmusik der Nazis“ (wie Ernst Bloch dies in Zusammenhang mit dem Vorspiel zu den ‚Meistersingern‘ mit guten Gründen abwehrte) interpretiert werden können. Bestes Beispiel: „Wenn man beim Walkürenritt sowohl an Bugs Bunny als auch an Hubschrauber denkt, kann die Musik fast alles bedeuten“. Denn das berühmte Musikstück wurde nicht allein in „Apocalypse now“ – in durchaus differenzierter Weise – , sondern auch in „The Birth of a Nation“ und bei Walt Disney zum Fliegen gebracht. Ross nennt auch die bedeutenden Vorläufer des Gebrauchs der Walkürenmusik in den Interferenzen zwischen Literatur und Film und den verschiedenen kulturellen Kriegskontexten: bei Proust, im Programmheft eines Toscanini-Konzerts und in einer Deutschen Wochenschau – was es schwer macht, die Musik Richard Wagners zu nazifizieren.
Haben die Philosophen Wagner dem Stresstext des Nazismus ausgesetzt? Natürlich. Denn Nietzsche hatte ja, siehe oben, behauptet, dass Wagner „die Modernität resümirt“. Auftritt der Wagner der Philosophen: Adorno, Lévy-Strauss, Badiou kämpft gegen Lacoue-Labarthe (der Wagner nicht mag), Zizek hat indirekten und negativen Kontakt zu Papst Franziskus. Ross rekonstruiert ein Gewebe von Bezügen, in denen die deutschen Nachkriegskünstler, die Syberberg, Kiefer, Schlingensief und Nitsch ihre Auftritte haben, bevor das heikle Thema „Wagner in Israel“ konzis und gerecht skizziert wird. Bleibt der Wagner der Fantasy-Autoren, die dem Schöpfer des „Ring“ so viel zu verdanken haben. Wagner ist nicht allein in Tolkien, er ist auch in Star Wars, in Matrix und bei Philip K. Dick. Es gibt da, in ‚VALIS‘, ein „Wagnertier“, das Amok läuft und sich unheimlich und grauenerregend verändert hat: „Ich erkenne es kaum wieder.“
Keine schlechte Metapher für Wagners Wirkung. Oder, wie Ross so schön schreibt: „Wagner bleibt das Monster im Herzen des modernen Labyrinths, dem man nicht entrinnen kann.“
Frank Piontek 30. April 2023
Alex Ross
Die Welt nach Wagner
Ein deutscher Künstler und sein Einfluss auf die Moderne
Rowohlt, 2020. 907 Seiten. 120 Abbildungen.
40 Euro.
