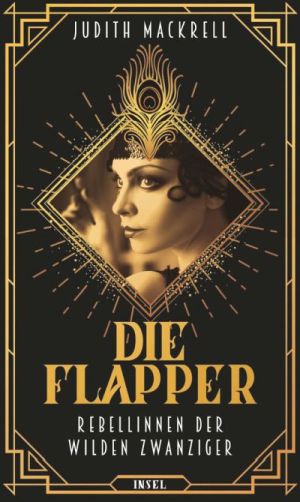
Nicht ohne die Ballett Russes
Nein, sie waren nicht „mutig, fröhlich und schön“. Zumindest waren sie‘s nicht immer, auch wenn Zelda Fitzgerald, als alles schon zu spät war, die Behauptung aufstellte, dass es wunderbar sei, zu den Flappern zu gehören.
Flapper? Die It-Girls, wie sie heute wieder heißen (denn es gibt sie, unter leicht gewandelten sozialen Verhältnissen, immer noch), die jungen Frauen, die sich, in Akten des „kultivierten Ungehorsams“, vor dem ersten Weltkrieg aus erstarrten Traditionen zu befreien begannen und nach dem großen Krieg zu ihrer Form fanden, bevor die Welt-wirtschaftskrise mit den sog. Goldenen Zwanzigern ein Ende machte – diese Frauen schrieben zwar Kulturgeschichte, hatten es aber meist mit Problemen zu tun, die alles andere als fröhlich waren. Der Euphorie einer frechen Spät-mädchenjugend und eines jungen Erwachsenendaseins folgte, nicht nur bildlich gesprochen, in vielen Fällen ein Kater, ein böses Erwachen, ein Hineinschlittern in eine Katastrophe. Kein Grund, sich nicht näher mit Zelda und ihren Freundinnen zu befassen.
Judith Mackrell, der wir ein Buch über das Leben im Palazzino der Peggy Guggenheim (noch so einer unverzichtbaren Protagonistin der Moderne) verdanken, legte mit „Die Flapper“ ein Buch vor, dessen originaler Untertitel schon einiges verrät: Six Women of a dangerous generation. Die Übersetzerinnen machten daraus „Rebellinnen der wilden Zwanziger“, was zwar, bezogen aufs Thema, nicht falsch ist, aber die Gratwanderungen minimiert, die die porträtierten Persönlichkeiten auszeichnete. Schon im Ansatz wird klar, dass die Persönlichkeiten der sechs Protagonistinnen so beschaffen waren, dass sie vieles einte, mehr noch trennte – oder sollte man sagen, dass die Schnittmenge denn doch größer war, als es die denkbar verschiedenen Lebensläufe einer Josephine Baker oder einer Lady Diana Cooper suggerieren würden? Mackrell kann, gerade aufgrund der Differenzen der Frauen, die sich zum Teil kannten (und sich selbst bisweilen nur schlecht beurteilen konnten), mit den Vertreterinnen der verschiedensten Künste, ganz wie im Nebenbei, eine Kulturgeschichte der Zwanziger erzählen, die tatsächlich die Epochengrenze zwischen 1918 und 1930 einhält. Während Cooper, trotz aller erotischen Eskapaden, noch die „Normalste“ war und als Darstellerin der Madonna in Max Reinhardts spektakulärer Inszenierung des von Engelbert Humperdinck komponierten Mirakels Erfolg hatte, zerschliss sich die Bordderlinerin Nancy Cunard auf dem Terrain von sex, drugs and alcohol, arbeitete allerdings auch am intensivsten am Projekt einer neuen, politisch aufgeklärten, literarisch unterfütterten Frauenbewegung. Tamara de Lempicka ging als Schöpferin ikonischer Gemälde in die Kunstgeschichte ein, wobei sie die Zeit nicht mitmachte, sondern miterfand. Tallulah Bankhead feierte, zumindest einige Jahre lang, Triumphe auf den englischen und US Amerikanischen Bühnen, während sie ihr extrem hedonistisches, dennoch von Unsicherheiten geprägtes Leben führte, als die labile Zelda Fitzgerald lediglich als Anhängsel ihres genialen Mannes, mit dem sie sich furchtbare Ehekämpfe lieferte, wahrgenommen wurde, bevor sie zu einem eigenen Ausdruck – und in die Psychiatrie fand. Zuletzt war es die schwarze Tänzerin, die kometengleich am Showbiz-Himmel aufstieg und nach dem Ende ihrer frühen Tanz-Karriere die Widersprüche zwischen ihrem Erfolg und der allgemeinen Unterdrückung der Schwarzen als Mitglied der Bürgerrechts-bewegung mit ihren Mitteln zu beseitigen suchte. Mag sein, dass auch sie, auf ihre unverwechselbare Weise, über jene „unerbittliche Intelligenz“ verfügte, die Frau den Flappern attestierte – immerhin vermochte sie es, anders als die Schauspielerin Bankhead, die Publizistin Cunard und die Schriftstellerin und Malerin Fitzgerald, am Ende ihres Lebens auf ein relativ geglücktes Leben zurückzuschauen. Eines aber haben die Frauen sicher gemeinsam gehabt: dass sie von Berühmtheiten und Gangstern, mehr oder weniger authentischen Aristokraten und großen Künstlern und Künstler-innen umgeben waren, zu deren Entourage sie mal mehr, mal weniger gehörten. Man muss nur in Lemickas Bilder schauen, um das Antlitz ihrer Epoche konkret zu sehen. Wer Cunard sagt, muss auch, im besten promiskuitivem Geist, Eliot, Pound, Tzara und Aragon sagen, die in Paris, London, New York und Venedig ihre Inspirationen fanden: manchmal eher an den Dämonen als an den Lichtgestalten, die extreme Persönlichkeiten wie Nancy Cunard selten zu sein pflegen.
Die Biographin erzählt diese Leben mit der Geduld, die angelsächsische Biographien vor allem in Bezug auf intimste Seelenregungen auszuzeichnen pflegen; zwischen gehässigem Partygeplauder und psychologisch relevanten Bemerkungen, den letzten Drinks auf einer der vielen, kaum unterbrochenen Parties und den letzten Erzählungen über gegenseitige hetero- wie homosexuelle Seitensprünge – und neue künstlerische Unternehmungen – passt da oft kein Blatt. Interessanterweise berührten die Frauen nicht allein diverse Drogen und Sexualpartner und -partnerinnen, sondern auch die gleichsam „hippe“ Opern- und Ballettszene der 20er: Nellie Melba schenkte der jungen Diana Cooper ein Grammophon, ihre Mutter nahm sie zum Auftritt einer Isadora-Duncan-Imitatorin mit, bevor Maud Allan in einer äußerst lasziven Performance die Salome tanzte. Sie lernte in London die Ballet Russes kennen (Leonid Massine wird später Tallulah Bankhead Tanzunterricht geben, während Zelda Fitzgeralds späte Versuche, mit Hilfe russischer Lehrerinnen und des berühmten Philadelphia-Ballets unter Catherine Littlefield eine Tanzkarriere zu starten, traurig scheitert), auch den berühmten russischen Bassisten Fjodor Schaljapin, der sie später unziemlich bedrängen wird, auch Hofmannsthal Sohn Raimund ist sehr an ihr interessiert – und sie tritt 1914 in einer Vorstellung von Debussys La Demoiselle Élue auf.
Der Dirigent Thomas Beecham ist der Liebhaber von Nancy Cunards Mutter, Ravel und Milhaud stehen Schlange, als Josephine Baker, die ein Kritiker als „Paradiesvogel der Tanzkunst“ bezeichnet, in Paris debütiert. Wir erhaschen einen Blick auf die Musikkultur der schwarzen Künstler in Harlem (und einen Seitenblick auf die erste schwarze Opern-sängerin, Katherine Yarborough), erfahren, dass nach dem ersten Weltkrieg in Covent Garden Filme gespielt wurden und betrunkene Soldaten auch in der Oper begegneten. Die Hochkultur von Figaros Hochzeit steht die Revue Shuffle Along gegenüber, in der die Baker erstmals auffiel – hier die Band Dixie Steppers, dort das Ballett Le Train Bleu, das dank Cocteau und Picasso in die moderne Ballettgeschichte einging – und gleichzeitig die Vergnügungssucht der Epoche theatralisch festhielt.
Spannend also, was uns die Zwanziger noch zu sagen haben – abgesehen davon, dass Vieles von dem, was damals gedichtet, gemalt, ersonnen wurde, heute zum Kanon der Kulturgeschichte gehört. Macht man sich jedoch klar, dass Aufklärung kein abgeschlossener Prozess ist, weibliche Unabhängigkeit immer wieder erkämpft werden muss und die Widersprüche, die ein auf totale Selbstbestimmung geeichtes Leben so mit sich bringen, eben dieses so „gefährlich“ machen, wird die historische Großstudie plötzlich zu einem aktuellen Beitrag zur Geschlechterdebatte. Doch schon die reinen geschichtlichen Fakten genügen, um zu zeigen, dass sich die sechs Auserwählten ihre Wege, zwischen Avantgarde und erweiterter Tradition, in einer kulturell ungeheuer reichen wie schwierigen Zeit freischlugen, die zum Nacherzählen geradezu provoziert. Muss man sich also darüber wundern, dass das bisweilen wurmstichige Glück nur zehn Jahre dauerte und nicht alle Flapper unbeschadet davonkamen?
Frank Piontek, 28. Oktober 2022
Judith Mackrell: „Die Flapper. Rebellinnen der wilden Zwanziger.“
Insel Verlag, 2022. 608 Seiten. 28 Euro.
ISBN 978-3-458-64290-9
