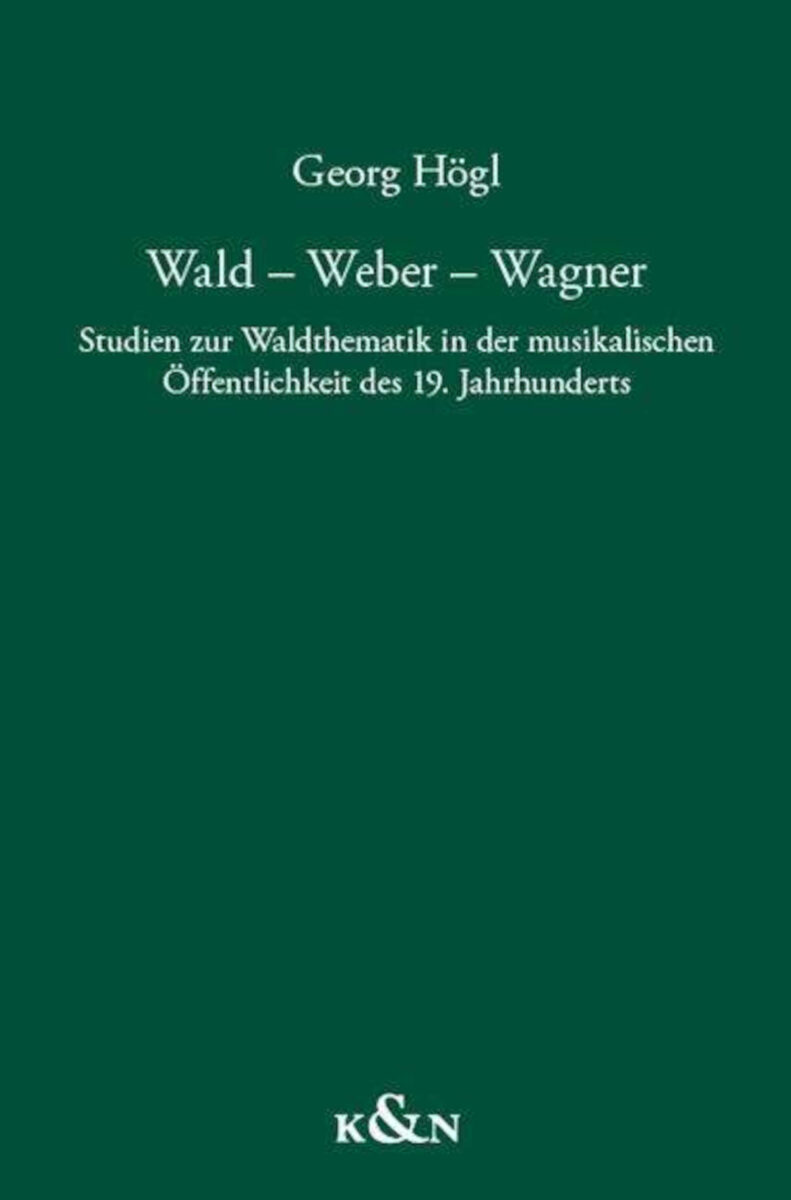
Der Wald stirbt. Dass etwas mit des Deutschen liebstem Freizeit-Aufenthaltsort etwas nicht in Ordnung ist, wusste man schon vor Jahrzehnten, ja: bereits im frühen 19. Jahrhundert gab es Stimmen, die aus ökologischen Gründen die Zerstörung des grünen Habitats durch die industrielle Revolution anprangerten. Just in dieser Zeit entstand das erste der beiden bekanntesten, bedeutendsten und beliebtesten Waldstücke des deutschsprachigen Musiktheaters. Carl Maria von Weber hat mit dem Freischütz bekanntlichdas Herz- und Magenstück aller deutschen Musiktheaterfreunde geschrieben, die den Wald und den Wald auf der Opernbühne lieben; rund drei Jahrzehnte später komponierte dann Wagner den Siegfried, in dessen örtlichem und zeitlich-dramaturgischem Mittelpunkt das sog. Waldweben steht.
Bedeutend? Wie bedeutend sowohl Webers und Friedrich Kinds „romantisch“ genannte Oper und Wagners Musikdrama, also der zweite Tag der Tetralogie, für die „Waldthematik in der musikalischen Öffentlichkeit des 19. Jahrhunderts“ wirklich waren: Ich behaupte, dass man es erst weiß, seit der Würzburger Dissertant Georg Högl sein Opus magnum mit dem konzisen Titel Wald – Weber – Wagner vorgelegt hat. Denn Högl erzählt uns nicht allein die Entstehungsgeschichte der beiden Werke, erläutert nicht „nur“ ihre Dramaturgie, kümmert sich nicht allein um die musikalische Gestalt der Werke. Er macht unmissverständlich klar, dass man die beiden Oper, ja: vermutlich Wagners Gesamtwerk, kaum adäquat zu begreifen vermag, wenn man nicht den Wald und seine besondere, nein: seine sehr besondere Bedeutung für die Deutschen im Auge hat (was Rückschlüsse noch auf unsere besondere Beziehung zum Wald zulässt), wie sie sich in Wagners Kunst-Denken seit den frühen 40er Jahren widerspiegelten. Wer sich auf die Suche nach den Intentionen der Autoren macht, die 1820 und 1850 zwei der wichtigsten Szenen ihrer Werke buchstäblich im Wald spielen ließen, wird nicht umhin kommen, sich mit der Vorgeschichte und dem historischen Hinter- und Vordergrund zu befassen, hinter und vor dem eine Wolfsschlucht und ein Waldweben erst möglich wurden. Die erste Hälfte des monumentalen Werks hat Högl also dem Ineinander von Kultur und (Musik-)Komposition, von Musiktheaterbildern und philosophischen Konzeptionen gewidmet, in denen die „Natur als Landschaft“, „Wald, Musik und Waldmusik“ im Sinne „romantischer“ Imaginationen und Realitäten eins werden. Seine Arbeit vereinigt in größter Souveränität Aspekte der Geistes-, der Musik-, der Theater-, der Politik- und der Forstwissenschaften, um eine Mentalitätsgeschichte zu entwerfen, deren „longue durée“, wie die Protagonisten der französischen Historikerschule der Annales das Phänomen nannten, bis heute wirkt. So verschränken sich die politische und die Kunstgeschichte, die Ideologie- und die Musikgeschichte im Zeichen eines Kulturkampfs, der im Grunde in einem antifranzösischen Affekt wurzelt, den zumal Wagner bis zuletzt kultiviert hat.
Praktischerweise hat Wagner selbst um 1840 und 30 Jahre später, bei der Konzeption seiner Schriften-Ausgabe, mehrere Aufsätze zum deutschen wie zum französischen, von Hector Berlioz bearbeiteten Freischütz vorgelegt, deren Analyse genauso spannend ausfällt wie die Interpretation der Musik Carl Maria von Webers und Richard Wagners. Im Zeichen der im augenscheinlich im böhmischen, tatsächlich im idealen deutschen Wald spielenden Freischütz-Szenen kann Högl nachweisen, dass schon der frühe Wagner seine Stereotypen einer wahren deutschen Kultur entwickeln konnte, die sich bis zum Parsifal, der ja nicht zufällig auch im Wald spielt, in Wagners Werken wiederfinden wird. Hier kann nur angedeutet werden, wie konsequent der Musikdramatiker sein Bild vom idealen Kunstwerk in den Szenen und Formulierungen seiner Werke, beginnend mit dem Tannhäuser, im ideal gesehenen – und gehörten – Wald zu entdecken meinte: ein Bild, das nicht neu war, aber mit Wagner seine schönste Ausprägung auf den Opernbühnen geschenkt bekam, um, über die propagandistischen Variationen des Kaiserreichs und der NS-Zeit („Ewiger Wald“), bis tief in die Gegenwart zu wirken. Dass kein deutscher Film der Gattung „Heimatfilm“ erwähnt wird, dürfte der Materialfülle und der notwendigen Begrenzung des Themas, nicht der Unkenntnis des Autors geschuldet sein. Es ist schlichtweg faszinierend (und kurzweilig!), dem Autor auf seinen Wegen durch das dichte Unterholz der Primär- und Sekundärliteratur zu folgen. Wir begreifen – man verzeihe die neuerliche, aber naheliegende Anspielung – dass Max und Kaspar und Siegfried und Fafner in einem Wald voller Motive stehen, die Högl wie ein Archäologe ausgegraben hat, um sie auch in vielen Fußnoten dem Leser auszubreiten. Wald – Weber – Wagner leistet mehrerlei: es begibt sich, nicht zuletzt mit Funden aus der Entstehungs- und frühen Aufführungsgeschichte ausgerüstet, auf die Suche nach Webers und Wagners Klängen – und deutet die Schriften Wagners, auch die kardinale über Oper und Drama, die Texte seiner Zeitgenossen und Nachlebenden derart bezogen auf die Werke, dass Letztere spätestens jetzt ihre Unschuld verloren haben – falls wir nicht schon vorher wussten, dass Mime ein Gnom ist, der nach Meinung Wagners und vieler Nachlebender in keinen „deutschen Wald“ gehören sollte; dabei verschweigt Högl an keiner Stelle das Problem der von Wagner problematisch erfundenen „Helden“-Figur im Widerspiel von erstem Textentwurf und Partitur: auch in Bezug auf das, was wir „Natur“ zu nennen pflegen. Neben der philologischen und musikologischen Analyse des „Waldwebens“ mitsamt seiner Waldvögel besticht der Wagner-Teil, abgesehen von der, wie gesagt, glänzenden Deutung der Freischütz-Aufsätze und der Siegfried-Textfassungen und -Entwürfe (und der Freischütz-Ouvertüre und der Wolfsschlucht-Szene und des Märchenmotivs „Alt wie der Wald“ undundund…), durch eine Darstellung von Wagners weiteren Wald-Bildern: im Briefwechsel mit Ludwig II., im Ring und weiteren Wagnerwerken (wunderbar: die Meistersinger-Sequenz, die „Buch“ – nicht „Buch’“! – und „Hain“ symbiotisiert), die jeden musikalisch und an Wagners Opern und Musikdramen interessierten Forstkundler begeistern müssten. Wenn schließlich das Festspielhaus in seiner spezifischen Form im Einklang mit den Quellen an seinem besonderen Ort als „Tempel im Wald“ der als „echt“ empfundenen, quasi neugermanischen Kultur gedeutet wird, sind wir wieder dort angelangt, wo wir einst aufbrachen: bei den Altvorderen und v.A. den Ansichten, die im 18. und, stärker noch, im 19. Jahrhundert über diese Urahnen herrschten (und selbst der Bayreuther „Studentenwald“ erhält seine Rolle in Wagners Lebenstheater, das ohne den Wald und die Metaphern, die er mit ihm erfand, nicht denkbar ist).
Dass die Werke nicht im zeitlosen Raum entstanden, dürfte inzwischen klar sein, auch wenn viele Opernbesucher immer noch der Meinung sind, dass sie völlig unabhängig von den Intentionen und den politisch-historisch-mentalitätsmäßigen Bedingungen verstanden werden können, denen die Schöpfer ausgesetzt waren und die sie selbst mit ihren Werken prägten. Högl legte mit seinem umfangreichen wie äußerst kurzweiligen Buch ein Werk vor, nach dessen Lektüre man ein wenig anders auf den Freischütz und den Siegfried schauen könnte als vorher: anders und genauer, was das nachhaltige Vergnügen an den genialen Werken ja nicht ausschließt Oder anders, mit einer letzten silvanischen Anspielung ausgedrückt: Man sieht den Wald vor lauter Bäumen schimmern, weben, in reizvollem Dämmer eintauchen. Dass Högl selbst vom Zauber des Waldweben und von den Teufeleien der genau gedeuteten Wolfsschlucht fasziniert, aber nicht eingelullt wurde: auch dies macht den Reiz des bedeutenden Buchs aus, das nicht nur von der fächerübergreifenden Quellenkenntnis des Autors, auch von seinem literarischen elan vital Auskunft gibt.
Es kann, nein: es muss allen Weber- und Wagner-Freunden empfohlen werden, die sich für den Ring, den Freischütz, die Kulturgeschichte der Oper im 19. Jahrhundert – und unsere anhaltenden Gründe für unsere eigene Wald-Begeisterung interessieren.
Frank Piontek, 9. Januar 2024
Georg Högl: Wald – Weber – Wagner.
Königshausen und Neumann, 2023
554 Seiten. 78 Euro.
