Ein Lesebuch, ein Nachschlagewerk, ein Kompendium, vor allem aber: ein Lesevergnügen – all das ist Oswald Panagls neues Opus. Erfreute er uns 2019 durch Im Zeichen der Moderne mit einem ersten, seine bisherigen (und zahlreichen) publizierten Aufsätze zusammenfassenden Großwerk zum Thema „Musiktheater zwischen Fin de Siècle und Avantgarde“, so schenkt er uns jetzt, quasi im Krebsgang, eine gleichartige Textsammlung, die uns zwischen Beethoven und den Operetten eines Johann Strauss und Carl Millöcker das Musiktheater des 19. Jahrhunderts aufschließt.
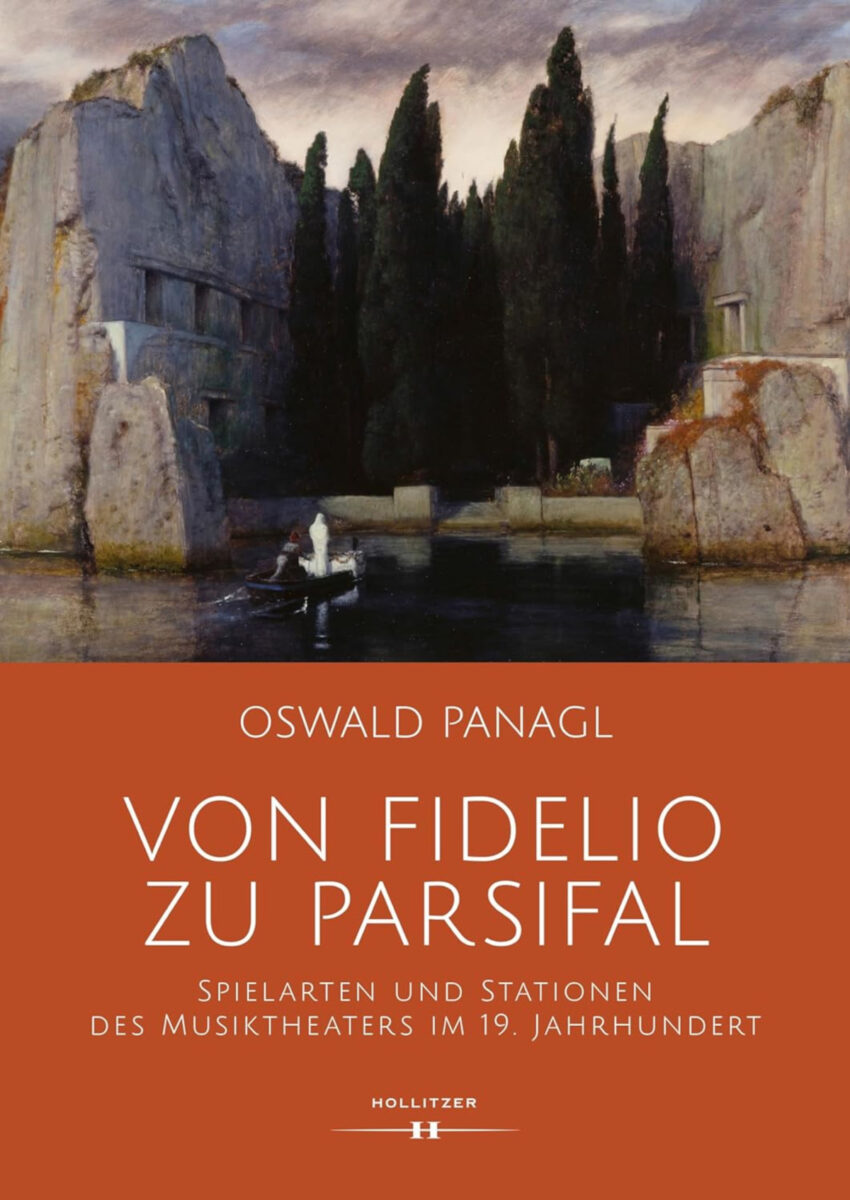
Wieder hat er 60 meist kleinere, doch stets gewichtige, weil thematisch konzentrierte Texte kompiliert, die in ihrer Bündelung wesentlich mehr geben als die berüchtigte Buchbindersynthese. Bislang fand man sie in Programmheften, die notorisch schwer zu bekommen sind, wenn man sie nicht zur Aufführungszeit in den betreffenden Theatern oder in den letzten Winkeln einschlägiger Wiener Antiquariate (ich sage nur: Kochgasse) erwarb. Natürlich ist, Panagl weist selbst darauf hin, eine derartige Sammlung eher den persönlichen Interessen und den glücklichen Zu-Fällen zu verdanken, aber es ist doch nach wie vor erstaunlich, dass ein Forscher, der „eigentlich“ Sprachwissenschaftler (Spezialgebiet: die mykenische Schrift und Sprache) ist, in den letzten Jahrzehnten so viele und vor allem: so profunde Beiträge zum Thema Oper zum Druck befördern konnte. Wagner-Freunde kannten ihn spätestens, seit er in den Programmheften der Bayreuther Festspiele, meist zusammen mit seinem guten Freund und Kollegen Ulrich Müller, veröffentlicht hat; im neuen Band finden sich deshalb nur wenige Texte zu Wagner, weil er die anderen bereits zusammen mit Müller in zwei voluminösen Büchern vorlegen konnte. Operettenfreunde kennen ihn, weil er zusammen mit Fritz Schweiger ein gutes Buch zur Fledermaus gemacht hat – und schreiben über die Oper kann er auch deshalb berufenerweise, weil er sich nicht allein auf der linguistischen Wiese tummelte, sondern auch als ausgebildeter Sänger weiß, wie man zwischen „Buch und Hain“, wie Wagner das genannt hätte, also zwischen der Gelehrsamkeit und der Praxis des Kunstwerks zu vermitteln weiß.
Beethoven und Weber, Lortzing und Flotow, Rossini und Donizetti, Meyerbeer, Berlioz und Auber, Offenbach, Bizet und Massenet, Verdi und Wagner, die großen Russen, Smetana und Mascagni & Leoncavallo: das sind die Paare, Terzette und Solitäre, denen sich Panagl gewidmet hat. Dazwischen gelegt: zwei Aufsätze zur musikalischen Gestalt des Faust, die natürlich blendend gut zu Berlioz passen und u.a. den französischen Teil um Gounod und seine wunderbare Faust-Oper vergrößern. Panagl kann Beides: Überblicke vermitteln und Einzelfragen erläutern. Er kann zudem das Recht des ausgebildeten Sprachwissenschaftlers, sich immer wieder linguistischen Rätseln und Eigenheiten wie den inhaltsreichen Namen der Protagonisten des Liebestranks zu widmen, in Anspruch nehmen, um, per exemplum, den Pagliacci/Bajazzo-Titel unter das Mikroskop zu legen oder sich in einer luziden Studie zu den Begriffen von Liebe und Tod, l’amour et la mort, zu äußern. Hand aufs Herz: wer weiß schon um die Bedeutung des Namens „Dulcamara“ oder den zwei (!) Bedeutungen des Namens „Belcore“? Doch erschöpft sich seine Arbeit nicht im Positivismus. Schon im Fidelio-Aufsatz, der, nach einem Gastbeitrag von Gernot Gruber, die Kollektion eröffnet, ist Panagls Stil offensichtlich. Es ist dies ein Stil des Ausgleichs, nicht der der (möglichen) Verurteilung: die Frage, ob es sich bei Beethovens einziger vollendeter Oper um ein Einzelstück oder einen Irrläufer, um einen ästhetischen Wurf oder ein missglücktes Experiment handelt, wird schier salomonisch beantwortet. Für Panagl ist Fidelio ein Werk an der „Schaltstelle zwischen Tradition und Fortschritt“, ein „Ausgangspunkt für künftige Entfaltungen“ (bis hin zur Elektra!)– kein „Problemstück“, wie’s neuere Lesarten aufgrund des oratorischen Schlusses so gern haben. Gleiche Gerechtigkeit lässt er den inzwischen fast von den Bühnen verschwundenen, noch in den 70er Jahren relativ oft gespielten Werken Albert Lortzings und Friedrich von Flotows zukommen. Geht es um Giacomo Meyerbeer, so findet er auch hier – nicht in einem Aufsatz, sondern in einem Gespräch mit Gottfried Kasparek – die bis dato ansprechendste und ausgeglichenste Klärung der Frage, wieso der Komponist, trotz Bemühungen der Meyerbeer-Gemeinde, noch keine Renaissance erlebte, wohl auch keine mehr erleben wird: „Seine Melodien sind gefällig, aber nicht zwingend. Die Koloraturen seiner Arien sind geläufig und perlend, jedoch zumeist nicht einprägsam und unverwechselbar. Die Accelerandi und Rubati wirken eher drängend als dringlich. Seine musikalische Ausdrucksweise ist elegant und hübsch, aber zugleich austauschbar und daher nicht triftig: oder, um ein Wortspiel zu riskieren, artig aber nicht einzigartig, sogar kaum ‚eigen-artig‘.“ Man kann die zweifellos zutreffende Meyerbeer-Kritik nicht nobler in Worte fassen als Panagl. Dass Spontini der „bessere Meyerbeer“ war: diese gleichfalls richtige Bemerkung Kaspareks fasst in einem einzigen prägnanten Wort die Rolle zusammen, die der leider auf unseren Bühnen nicht besonders präsente Italiener innerhalb der Opern- und Musikgeschichte einnimmt.
Man könnte nun ein seitenlanges Florilegium aus „schönsten Stellen“ zusammenstellen, in denen sich pointierte Schlüsse und genaue Beobachtungen ein Stelldichein geben. Informierte Textanalysen verbinden sich mit souveränen Querschnitten, zurückhaltende Sprachspiele mit interpretatorischer Tiefsicht. Als Sprachwissenschaftler verfügt Panagl über die Fähigkeit, Libretti im Sinn des Gesamtkunstwerks namens Oper Ernst zu nehmen: dies im Unterschied zu all jenen „Opernfreunden“, die immer noch der irrigen Meinung sind, dass die sprachlichen Schichten eines Musiktheaterstücks „bekanntlich“ nur „Blödsinn“ seien – Wagners ingeniöse Texte eingeschlossen. Man lese nur seine Interpretation des Freischütz, um zu begreifen, dass bei Kind und Weber jedes Wort an der richtigen, im Sinne Goethes bedeutenden Stelle steht. Wie anders denn könnte man Max’ „existentieller Erfahrung“, die er in der Wolfsschlucht und im zunächst katastrophischen Finale erfährt, nahe kommen, nähme man nicht alle Informationen zur Kenntnis, die uns das Textbuch bereit stellt? Literarhistorische Kontextualisierungen (man denke nur an das „Weltschmerz“-Thema in Zusammenhang mit dem Eugen Onegin), wie sie Panagl allenthalben vornimmt, tragen daneben das Ihre dazu bei, den Sinn der großen Werke zu entschlüsseln und das Besondere eben dieser Werke kenntlich zu machen – auch auf musikalischer Ebene.
Der glückliche Rezensent könnte noch seitenlang über die Meriten des Bandes berichten: über die weiteren Wortdeutungen (z.B. „Là-bas“ in Zusammenhang mit Carmen), über seine musikalisch-dramaturgischen Tiefenbohrungen zumal in Zusammenhang mit Verdi (Aida und vor allem La Traviata), über seine Annäherung Verdis an Wagner (der Falstaff-Aufsatz ist ein Glanzstück des Bandes), über die Zeichnung von Charakteren (Die verkaufte Braut), über literarische Figuren und Entwicklungen, über seine fachwissenschaftlichen, doch gar nicht trockenen Erläuterungen linguistischer Befunde und Fundstücke (wie beim Parsifal, in dem er Momente der „sprachlichen Askese“ entdeckt). Man liest das alles mit größtem Vergnügen und möchte nur an einer einzigen Stelle widersprechen, an der es ausgerechnet um Beckmesser geht. Dass der intrigante, stets gehässige und zu künstlerischen Taten unfähige Stadtschreiber mehr sei als ein verbohrter Karrierist und impotenter Nicht-Artist ist eine These, die nicht beweisbarer wird, wenn man Walter Jens’ idealistischen Aufsatz zur „Ehrenrettung eines Kritikers“ zitiert. Aber, wie gesagt: hier, und nur hier, begibt sich der Rezensent auf das Glatteis des Beckmesserns. Viel wichtiger aber ist die Beobachtung, dass gleich neben der Beckmesser-These die sprachlich eindeutig vermittelte und begründete Übersetzung des vielfach inkriminierten und selten verstandenen, durchaus nicht bös nationalistischen Wortpaars „deutsch und echt“ (= „vertraut und volksverbunden“) steht. Man braucht eben, um die historischen und zunächst (!) aus ihrer eigenen Zeit zu verstehenden Meisterwerke zu begreifen, die Hilfe eines Fachmanns. Wenn er dann noch so zu schreiben vermag wie Panagl: umso besser.
Schließlich wäre es schön, wenn noch ein dritter, wenn auch wohl nicht mehr so umfangreicher Band zum Musiktheater und zur Musik aus Panagls Hand erscheinen würde: wieder im Krebsgang. Denn hat der Autor nicht auch einiges Gute zu Mozart und Co. veröffentlicht? Er hat. Zusammen mit einigen Nachträgen zu den Themenkomplexen Literatur und Musik ergäbe das ein weiteres schönes, nein: sehr schönes Lesebuch…
Frank Piontek, 13. Februar 2024
Oswald Panagl
Von Fidelio zu Parsifal.
Spielarten und Stationen des Musiktheaters im 19. Jahrhundert.
Mit Geleitworten von Brigitte Fassbaender und Manfred Trojahn.
368 Seiten. Verlag Hollitzer, Wien 2024.
