Der Schwan von Pesaro in Wien
Viel zu verdanken hat der italienische Opernkomponist Giacchino Rossini dem unermüdlichen Schweizer Opernforscher Reto Müller, der nun auch für die Herausgabe des zwölften Bandes der Schriftenreihe der Deutschen Rossini Gesellschaft und zwar des Tagungsbands mit dem Titel Rossini in Wien verantwortlich zeichnet. Die Tagung fand 2022, genau zweihundert Jahre nach dem Gastspiel Rossinis und seiner aus Neapel stammenden Operntruppe, die auch die ihm frisch angetraute Sängerin Isabella Colbran umfasste, in Wien statt, und das Buch beleuchtet das Ereignis in überaus vielseitiger, mehr oder weniger erhellender Art.
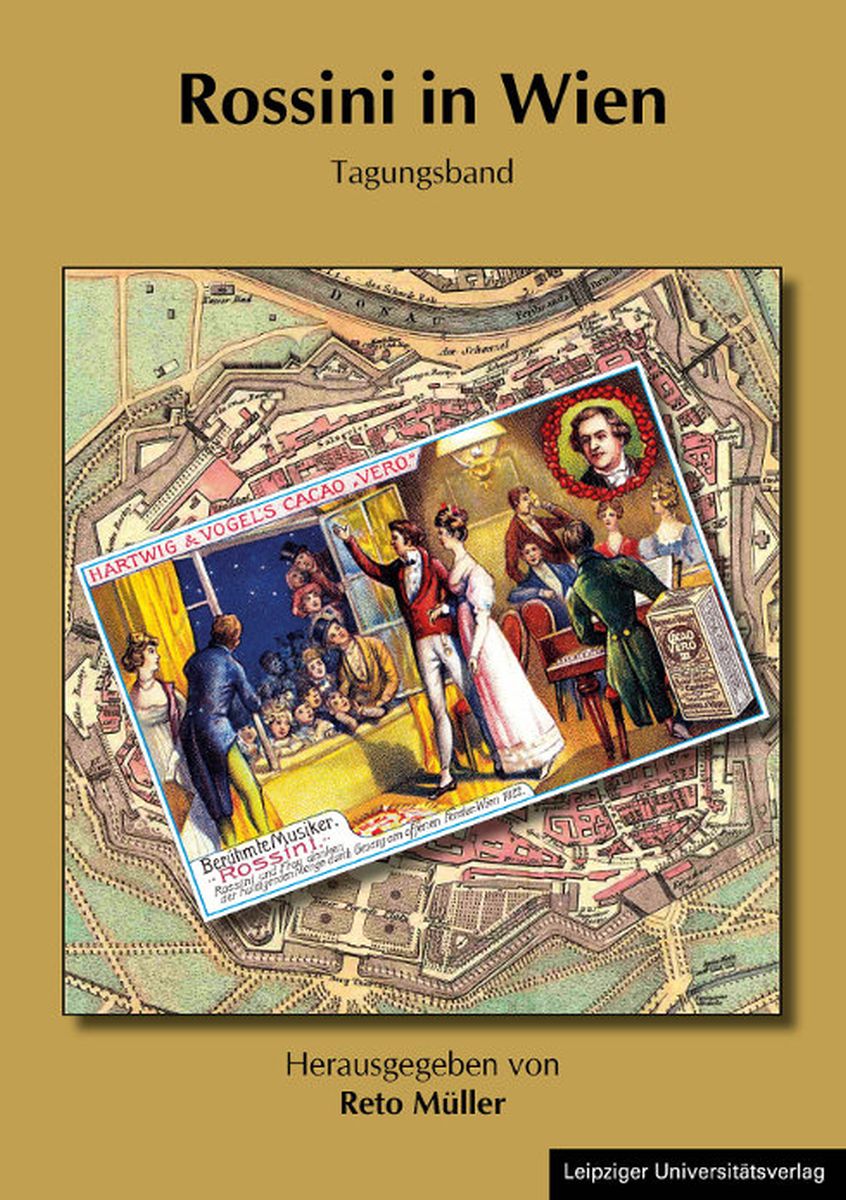
Abgedruckt sind das Programm der Tagung und das eines im Zusammenhang damit veramstalteten Konzerts mit Mitgliedern der Opernklasse des mdw. Es schließt sich ein Vorwort des Vorsitzenden der Rossini Gesellschaft, Jakob Lehmann, an, das dem Leser wohl das erste zustimmende Nicken abnötigt, denn auch er wird sich wie der Verfasser fragen, warum Wien, nicht aber Bologna, Pesaro, Neapel oder Paris zum Gegenstand der Tagung wurde. Immerhin gibt es gewichtige Gründe für die Wahl Wiens, das als Ort der Vermittlung zwischen Nord und Süd gelten kann und wo Rossini während des monatelangen Aufenthalts bedeutende Erfolge erzielte. Es folgt unter dem Titel Vorbemerkungen ein Bericht Reto Müllers über die durch Corona erschwerten Vorbereitungen der Tagung, die Gewinnung von 24 Referenten und die die Lektüre erleichternde Übersetzung der fremdsprachlichen Beiträge ins Deutsche.
Jeder Leser des umfangreichen, immerhin fünfhundert Seiten umfassenden Bandes wird den Schwerpunkt seines Interesses bei unterschiedlichen Artikeln finden, die eng am Thema Rossini und Wien verharrenden bevorzugen oder ihen ausweichen, dem weit ausschweifenden, das Thema verlassenden etwas abgewinnen oder ihn als unpassend empfinden, so dass auch eine Beurteilung des Gesamtbandes schwer und nicht einheitlich ausfallen kann.
Viel Gewinn und neue Erkenntnisse ziehen kann der Leser sicherlich aus dem Beitrag Reto Müllers, der sich mit der eng begrenzenden Frage befasst, ob es eine Begegnung zwischen Rossini und Beethoven im Jahre 1822 gegeben hat. Der Beitrag ist spannend wie ein Krimi und gewissenhaft abwägend wie eine wissenschaftliche Abhandlung, konfrontiert den Leser mit einer Fülle von Quellen, die kritisch beäugt und nicht ohne Humor dargestellt werden, so die Aussagen des wortreichen Edmond Michotte, der Rossini Jahrzehnte mach dessen Wienaufenthalt befragte.
Eine Art Gegenpol zu diesem so sachlichen wie unterhaltsamen und humorvollen Beitrag bietet Anke Chartons Die Italienerin in Wien: Performativität und verkörperte Vokalität im Rossini-Gesang, in dem gendernd über „gegenderte Darstellung“ geschrieben, über „Gruppenhierarchie nach Fachprinzip“ referiert und zur Schlussfolgerung gekommen wird, dass Rossinigesang lesbar sei als „gegenderte, verkörperte Vokalität“. Da kehrt man gern zurück zu sich tatsächlich an Wien und 1822 haltende Beiträge wie Melanie Unselds „Super Couple“ oder „Compositeur, sammt Gattin“, wo sich an Quellen gehalten wird, wie in Martina Gremplers Beitrag über den Übersetzer Grünbaum, wagt gern auch einen Blick ins von Rossini verlassene Neapel in Paolo Fabbris und Maria Chiara Bertiers Aufsatz.
Beachtenswert ist auch Ilaria Naricis Einsicht, dass Rossini durch seinen Erfolg in Wien den endgültigen Durchbruch als europäischer Komponist vollzog, sind die Erkenntnisse über das Wirken von Impresarii wie Domenico Barbaja, das Auf und Ab, was die Aufführungszahlen von Rossiniopern in Wien betrifft, denn nach dem Rossini-Fieber setzte eine schlimme Vernachlässigung ein, ehe durch Pesaro und Alberto Zedda eine Wiederentdeckung stattfand.
Marco Beghellis Beitrag über den Tenor Giovani David kann man entnehmen, welche Anforderungen die Musik Rossinis an die menschliche Stimme stellte und wie der gefeierte Sänger diese erfüllte, ob Falsett oder nicht zum Rossinigesang gehört, wer nun eigentlich als Erster von ihm Abschied nahm. Das geht zwar über das Tagungsthema hinaus, erfreut aber durch die „Praxisnähe“ zum Singen.
Gewinn ziehen kann der Leser auch aus dem Vergleich der beiden Fassungen von Elisabetta, regina di Inghilterra, die eine für Neapel, die andere für Wien bestimmt. Vincenzo Borghetti ist der Autor. Verzichtbar, wenn auch amüsant ist Guido Johannes Joergs Beitrag über Kanone und Kanon trotz der niedlichen Kanönchen im Text, müßig ist es, sich zu fragen, warum Rossini als Opernkomponist erfolgreicher war als Schubert. Auch das Verlagswesen wird kontaktiert von Fabian Kolb, wenig Berührungspunkte gibt es zwischen Raimund und Rossini (Bernd-Rüdiger Kern), und dem Vermarkten auch von Rossini-Ouvertüren für den Gebrauch beim Musizieren zu Hause wird Rechnung getragen (Simone Di Crescenzo). Joachim Veit hingegen widmet sich dem Vergleich mit Weber in Wien 1822/23 und das Verhältnis von deutschem und italienischem Ensemble der Hofoper.
Der Band bietet ein überaus breites Spektrum von vielen mehr oder einigen weninger das Thema berücksichtigenden Beiträgen, die stilistisch ebenso breit gefächert erscheinen und ein vielfarbiges Bild des Schwans von Pesaro und des Wiener Opernlebens malen.
Ein umfangreicher kritischer Apparat und ein Anhang, bestehend aus Personenregister, Werkregister und Sachregister vervollständigen das Buch.
Ingrid Wanja, 10. Juni 2024
Rossini in Wien
Tagungsband
Herausgegeben von Reto Müller
Leipziger Universitätsverlag 2024
500 Seiten
ISBN 978 3 96023 576 7
