Erst kürzlich kam ein Tagungsband heraus, in dem das nicht auf einen Nenner bringbare Verhältnis von Wagner zu Weber in sieben Kapiteln anregend diskutiert wurde (unsere Buchbesprechung dazu). Unter den Weberschen Opern spielten Euryanthe und Der Freischütz – neben einigen marginalen Bemerkungen zum wunderbaren Oberon – die Hauptrollen. Im selben Verlag erschien bereits 2021 ein Band zur 200. Wiederkehr der Uraufführung von Webers beliebtester Oper – dass es sich hier wie dort um genau 7 (in Worten: sieben) Aufsätze handelt, die uns präsentiert werden, dürfte nur dem wie ein Zufall erscheinen, der sich nicht auf die Zahlenmystik verlässt, die von Tom Adler (der gleichfalls hier wie dort mit einem profunden Beitrag verbunden ist) als eine der bislang noch unausgeloteten Möglichkeiten ins deutende Freischütz-Spiel gebracht wird.
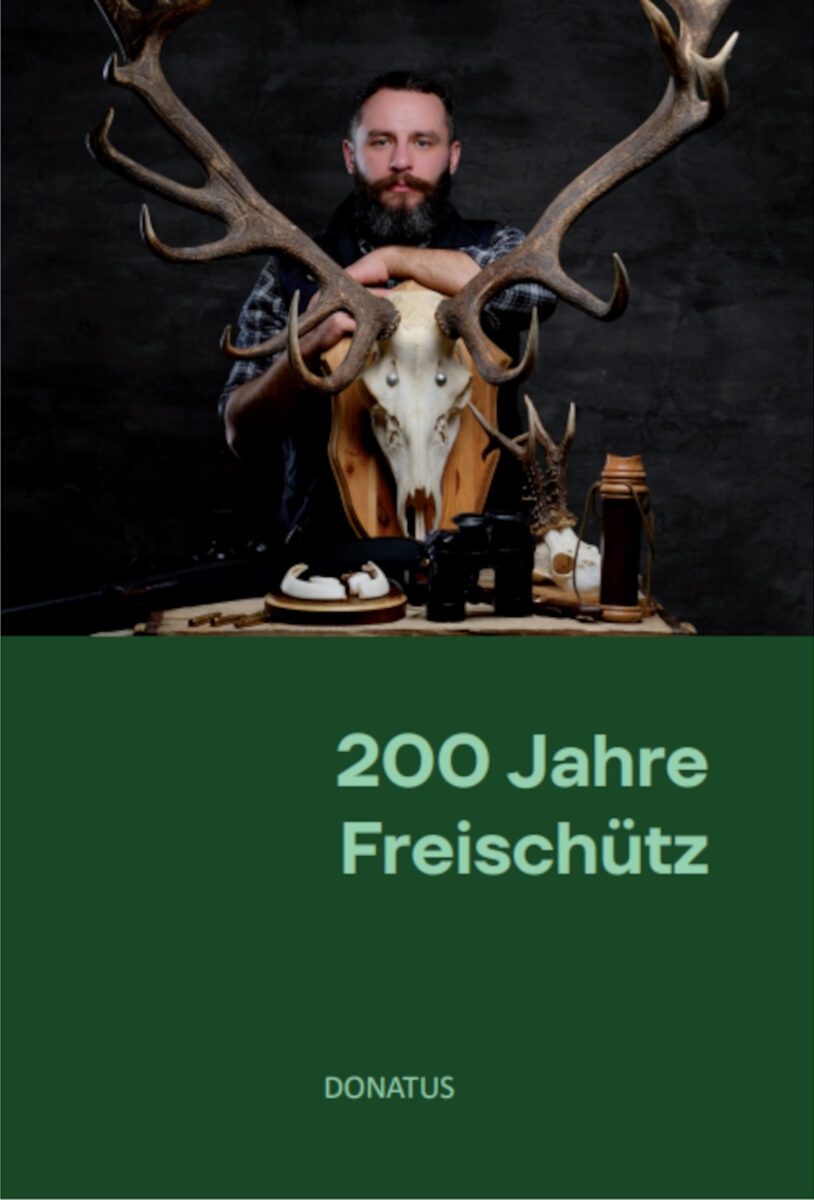
Natürlich – man „weiß“ ja schon alles über die Oper, über die denkbar viel publiziert worden ist. Tatsächlich ist es immer noch möglich, Aspekte zu entdecken, an die vor zehn, zwanzig oder fünfzig Jahren kaum ein Wissenschaftler, Musiker oder Opernbesucher gedacht hätte. Dass sich die Werke, die scheinbar „immer gleich“ scheinen, mit der Zeit und ihren Betrachtern wandeln, ist eine Binsenweisheit, allein sie muss schon deshalb immer wieder formuliert werden, weil das gelegentlich als „werkfremd“ inkriminierte und ach so grundböse „Regietheater“ gelegentlich Züge in den Werken der Meister entdeckt, die so zeitverhaftet sind wie sie den Werken selbst innewohnen. Wenn Richard Erkens in seiner psychologisch überaus feinen und stimmigen Untersuchung in Max einen Amokläufer entdeckt, der bis ins Finale hinein nach den irren wie rational verständlichen Gesetzmäßigkeiten eines seelisch Geschädigten operiert, wie wir ihn aus Funk und Fernsehen kennen, legt er nichts in Webers Musik und Friedrich Kinds Libretto hinein, was nicht in ihm verborgen wäre. Man muss es nur zu lesen wissen; es steht alles bereits an der Oberfläche (was nicht heißt, dass man radikale, zu guten Teilen den Obsessionen des Regisseurs zu dankenden Deutungen wie jene gut finden muss, die Calixto Bieito 2012 samt über die Bühne schnürender Wildsau an der Komischen Oper zu Berlin ablieferte). Den Freischütz als „poetische Bilderwelt des inneren seelischen Erlebens“ der Titelfigur zu deuten, ist gut, weil es dem Interpreten gelingt, die einzelnen Phasen des Amoklaufs, die ja nicht mit der Tat beginnen, an der Partitur wie am Libretto dingfest zu machen. Um Erkens zu zitieren: das Thema des Amoklaufs ist eine „subkutane Sinnschicht des Werks. Dass das Wissen um die erschütternden Amokläufe der jüngsten Vergangenheit sensibilisierend wirkt und auf vergleichbare Symptome retrospektiv aufmerksam macht, steht außer Frage.“
Außer Frage steht auch, dass weite Teile des Freischütz-Texts nur dann genau verstehbar sind, wenn man sich parallel zur Lektüre des Librettos den fünften Band des Handwörterbuchs des deutschen Aberglaubens daneben legt. Tom Adler unternahm es, alle diesbezüglichen Stellen, die vor Allem beim Freikugelgießen in der Wolfsschlucht begegnen, vor den Hintergrund der volkskundlichen Forschung zu erläutern, was nicht allein dem Folkloristiker Spaß machen dürfte. Spekulativer erscheinen da schon die zyhlenmystischen Spekulationen, die vergessen machen sollen, dass Weber seine Musik für ein hörendes, nicht für ein lesendes Publikum schrieb, dem die musikalische Kabbala so gleichgültig wie unhörbar war und nach wie vor ist, auch wenn sich bemerkenswerte Zahlenverhältnisse in Webers Musik finden lassen. Sympathisch aber, dass Adler seine im Übrigen gut begründeten Thesen selbst nicht für der Weisheit letzten Schluss hält: „Apropos: Der Freischütz – zählen Sie einmal Buchstaben!“, merkt er schließlich ironisch an.
Das Neue im Alten aber zeigt sich nicht allein in der Deutung. Schon die Frage, wie der originale Freischütz zu klingen hat, berührt die Authentizität, die in Weber in seiner Partitur-Handschrift festhielt. Nikolaus Harnoncourt, der die Oper 1995 mit den Berliner Philharmonikern einspielte, hat dazu seinerzeit Folgendes bemerkt: „Das Autograph ist fehlerfrei! Es ist übrigens ein schöner Faksimile-Druck davon gemacht worden. Mein zentrales Erlebnis war: Bei den späteren Ausgaben ist alles in Analogie gleichgemacht worden, auch und gerade da, wo Weber außerordentlich fein differenziert hat.“ Von diesen Differenzierungen und Verfälschungen erzählt der spannende Beitrag von Reiner Zimmermann, der 1976 mit dem zitierten Faksimile-Druck beschäftigt war; ist auch keine Note anders, so macht der Ton bekanntlich erst die Musik. Es ist eben ein Unterschied, ob eine Note einen Staccato-Punkt oder einen Keil hat, ob die Posaunen piano oder forte zu spielen haben, ob die Wellenbewegungen der Violinen in Maxens Arie von Beginn an Bindebögen aufweisen oder erst ab einer bestimmten, betont lyrischen Stelle. Dass es nicht „nur“ auf die Partitur, sondern, da die Musik immer noch von Menschen gemacht wird, auf die Spieler ankommt: auch dies ist eine Binsenweisheit, die nicht genug betont werden kann. Der Hinweis auf die Tradition, mit der der Freischütz von der Dresdner Hof-, dann Staatskapelle so und nicht anders gespielt und artikuliert wurde, spiegelt also ein Stück Aufführungsgeschichte, die bei der Betrachtung dessen, was Weber wollte, nicht ignoriert werden darf.
So wird die „wegweisende“ Wirkung der romantischen Oper, die im Vorwort erwähnt wird, durch all jene Beiträge von Neuem und originell vertiefend erhellt. Historisch interessant ist die konzise Entstehungsgeschichte und das Nachleben der Oper zwischen Huldigung, Satire, NS-Missbrauch und Gegenwart (Romy Donath), die kurzweilig erzählte und in die Leipziger und Dresdner Kulturgeschichte detailliert eingebettete Biographie des Librettisten (Steffi Böttger). Der Leser bekommt auch einen Einblick in die Probleme des (fehlenden) Urheberrechts, die mit Kinds Person elementar verbunden sind. Ein lokaler Beitrag führt kurz in die Karriere des Werks bei den Opernaufführungen auf der Felsenbühne Rathen ein (Romy Donath). Schließlich erläutert der Maler Guido Lipken seine Freischütz-Ansicht, die sich von der Anlage entfernt, die Kind und Weber der Figur gaben, sie aber, wie es heute heißt, weiterdenkt: in Richtung Queerness.
Es muss nicht jedem gefallen, zeigt aber, welche Deutungsmöglichkeiten die Oper und ihre Figuren besitzen. Es ist dies zweifellos ein Signum jener wegweisenden Wirkung, die zwischen 1821 und 2025 mit den verschiedensten Bemühungen um das vielschichtige Werk fortgeschrieben wurde: nicht immer zum Nachteil der Oper, die zwischen der Theorie der Wissenschaft und der Praxis der Aufführung ihre Lebendigkeit bewahrt hat. Ein Ende mit der Beschäftigung mit dem so ganz und gar nicht „biedermeierlichen“, sondern abgründigen Werk ist nicht abzusehen, zumal das echte „Biedermeier“ eine Epoche der Restauration und des Obrigkeitsstaats war, der im Freischütz, kurz nach dem Wiener Kongress, fröhliche Urständ feierte. Dass und wie sich die Konflikte Bahn brachen: auch davon erzählt die Oper – und das Buch.
Dass Weber und Kind sich über manch Deutung im kleinen, doch wichtigen Band vermutlich wundern würden, verschlägt nichts, ja: ist sogar unausweichlich. Wie Richard Erkens am Ende seines Aufsatzes bemerkt: „Das ohnehin vielfältige Deutungsspektrum des Freischütz scheint daher auch in seinem runden Gedenkjahr noch nicht vollständig ausbuchstabiert zu sein“. Dies schließt das Glück, eine wie auch immer gelungene Freischütz-Aufführung zu erleben, ja nicht aus. Das Bändchen tut beim Ausleuchten der Hintergründe und des trotz vieler „kritischer“ Inszenierungen der letzten Jahre gar nicht so bekannter Gehalt des Werks auf jeden Fall gute Dienste. Und schön illustriert ist es außerdem: so wie die dunklen und lichten Bildwelten des Freischütz.
Frank Piontek, 4. Februar 2025
200 Jahre Freischütz.
Festschrift des Carl-Maria-von-Weber-Museums.
Hrg. von Romy Donath.
Donatus Verlag, Niederjahna 2021.
124 Seiten, 50 Abbildungen. 19,95 Euro.
