„Carl Maria von Weber als Wegbereiter Richard Wagners?“ – das Fragezeichen steht an der richtigen Stelle. Denn ausnahmslos alle Autoren gehen zwar davon aus, dass Weber zeitweise ein „Meister“ für den jungen und den mittelalten Wagner gewesen sein könnte, doch hat man sich längst von der Idee verabschiedet, dass Wagner auf dem Gebiet der deutschen Oper der „Vollender“ Webers gewesen sei.
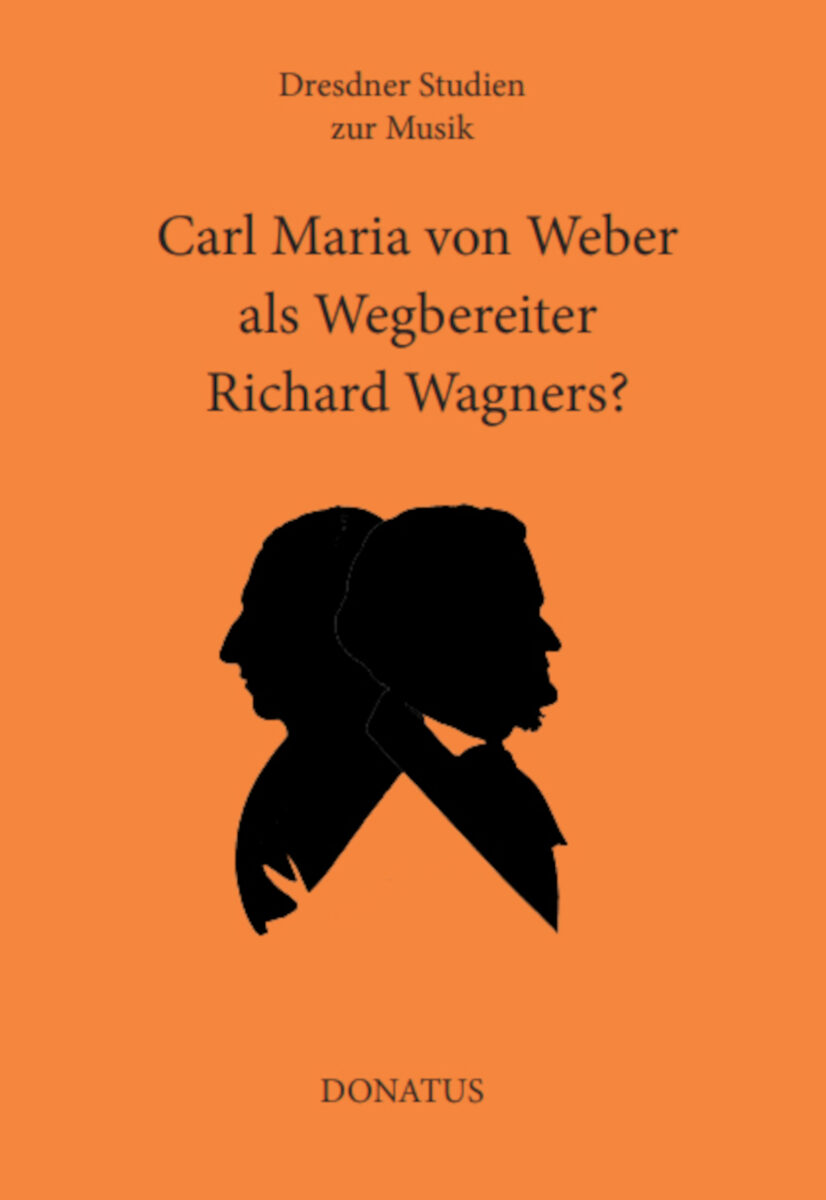
Hosterwitz, wo der Komponist des Freischütz (und der Euryanthe und des Oberon…) einige Sommermonate lang lebte und arbeitete, liegt in der Nähe des ehemaligen Guts Goß-Graupe, dem heutigen Graupa bei Pirna, wo Wagner in einem für ihn und die Operngeschichte höchst glücklichen Sommer den Kompositionsentwurf des Lohengrin schrieb. Grund genug also für die Leiter der jeweiligen Komponisten-Museen, sich zusammenzusetzen, um ein Symposion über die Beziehung der beiden Herren zu veranstalten. So fand, während die Weber-Wagner-Ausstellung in Hosterwitz noch lief, im März 2023 eine Tagung im Jagdschloss zu Graupa statt, in der man eben jene Titelfrage stellte: War Weber wirklich (nur) ein „Wegbereiter“ für Wagner?
Wie gesagt: Weber gilt heute nicht mehr als „Vorläufer“ Wagners, der „nur“ das angelegt hätte, was Wagner dann „vollendet“ habe, doch rasend viele Studien liegen zum sinnvollerweise vergleichenden Thema noch nicht vor. Um sich der Frage zu nähern, gingen die fünf Beiträger und Romy Donath, die zusammen mit Wolfgang Mende (ehemals Graupa) den Band edierte, 1. biographisch, 2. werkgeschichtlich vor. Die Frage, ob Wagners Verehrung Webers als „Meister“ so eindeutig, wie gelegentlich kolportiert, war, ist zumindest klar zu beantworten: Sicher nicht. Denn Wagners Meinungen über Weber wechselten durchaus: von der ersten, in die Jugendjahre Wagners fallende Polemik gegen den Mann, der angeblich keine gute deutschsprachige Oper zu schreiben vermochte, bis zur Überzeugung, dass er und kein anderer sein größtes Vorbild gewesen sei. Auch die biographischen Bezüge zwischen Webers und Wagner Familien waren durchaus nicht so vorbehaltlos positiv, wie Wagner dies später, als er durch seine Autobiographie Mein Leben seinen Selbst-Mythos in eine monumentale Form goss, darstellte. Da war, Romy Donath macht das deutlich, viel an Verklärung im Spiel: vom ersten Bühnenauftritt des blutjungen Knaben Richard Geyer in Friedrich Kinds (des Freischütz-Textdichters) Weinberg an der Elbe, zu dem Weber ein Musikstück beisteuerte, über die auch publizistische Begegnung mit dem Freischütz bis zum späten Eingeständnis von 1881, dass der Ältere „mein Meister“ gewesen sei – 50 Jahre, nachdem Wagner dem Komponisten allerlei Böses hinterhergerufen hatte. Georg Högl, dem wir eine so monumentale wie hervorragende Schrift über den durchaus deutschen Dreiklang von Wagner, Weber und dem Wald verdanken, zitiert das Wort von „Bewunderung, Kritik und Kalkül“, die Wagners Weber-Bild formierten.
Frank Ziegler widmet sich, die biographischen Spuren aufnehmend, den Familienbeziehungen; man erfährt von Neuem (und mit genauen Daten und Stücktiteln nun auch vertieft), dass Wagner Stiefvater Ludwig Geyer Mitglied des Weberschen Opernensembles war – und dass man sich am 10. März 1820 zusammen mit dem Mozartsohn Franz Xaver einmal traf. War der junge Richard dabei? Wir wissen es nicht, können es nur annehmen. Interessant auch die Einschätzungen Caroline Webers, der Witwe des Meisters: fand sie zunächst den Rienzi, auch den Holländer durchaus anhörbar, wählte sie später, zumal in der Revolutionszeit, ausschließlich kritische wie hellsichtige Worte gegen den Revolutionär. Ebenso interessant: der Plan einer Vollendung des Weberschen Opernfragments Die drei Pintos durch Wagner und – Meyerbeer. Aus dem Plan wurde bekanntlich nichts; erst Gustav Mahler hat Jahrzehnte später das Werk aufführungsfertig gemacht (im Übrigen: Schade, dass es kaum gespielt wird).
Mehr als eine Annahme ist die begründbare Vermutung, dass zwischen der ersten vollendeten Oper Richard Wagners und C.M. von Webers Opern direkte Abhängigkeiten bestehen, auch wenn – Tom Adler und Wolfgang Mende weisen mehrmals darauf hin – angesichts unserer Unkenntnis des Repertoires der damaligen Epoche Ähnlichkeiten nicht immer auf Webers Vorbild zurückgehen müssen. Wer Tom Adlers Beitrag über Die Feen liest, erhält nicht nur, seinem guten Beitrag im letzten wagnerspectrum über Wagners Frühwerke folgend, eine Ahnung von der Macht, die von Webers Meisteropern auf den Jungkomponisten ausgestrahlt haben muss. Adler, der gerade an einer großen Arbeit über Die Feen sitzt, lässt die Vermutung zu, dass das Junggenie sich in Sachen Ouvertüre (Stichwort: Sonatenhauptsatzform mit verkürzter Reprise) Figurengestaltung und -Dramaturgie, auch in Sachen (Leit-)Motivik an Weber anlehnte. Damit füllt er Teile einer Forschungslücke, die von Wolfgang Mende in Form eines sehr dichten Aufsatzes über den Weg vom Weberschen zum Wagnerschen Leitmotiv weiter geschlossen wird. Tatsache ist, dass das, was der junge Wagner als „allegorisierendes Orchestergewühl“ bei Weber noch denunzierte, was Weber also in höchst subtiler, wenn auch im Vergleich zum reifen Wagner in zurückhaltender Form im Freischütz und der Euryanthe praktizierte – Tatsache ist, dass Wagner sehr gut wusste, was er dem Älteren an Motivarbeit, Farbklangdramaturgie und musikalischer Bearbeitung des „Ganzen“ einer Oper zu verdanken hatte. Denn schon bei Weber dienen die als „Leitmotive“ identifizierbaren Themen nicht als „Visitenkarten“ (wie Debussy später spöttisch über Wagners System schrieb), sondern als Variationen zur Kennzeichnung von inneren Gefühlszuständen, auch als das Wissen eines Orchesters, das gleichsam als (griechischer) Chor die Handlung kommentiert: wie im Schlangenmotiv der Eglantine, das sich gleichsam schlangengleich und psychologisierend durch die Partitur der Euryanthe windet. Mende spricht auch von „gestisch-expressiven Instrumental-Topoi“, die zum Inventar der „romantischen“ Oper gehören – Wagner kannte und nutze es, auch wenn er die Rezitative und den sprachlichen Gestus des Werks als zweitklassig abtat. Von der „Samiel-Chiffre“ führt, Mende kann das en detail belegen, ein Weg in Fafners nächtlichen Wald, vom Weberschen Dämon zum „Alberich-Klang“. Und Wagner selbst hat ja schon auf das Ausdrucksvermögen verwiesen, dass zumal Klarinette und Oboe bei Weber besäßen. Von hier führt schließlich ein Weg zum Lohengrin, dem Höhepunkt und zugleich dem Abschluss der sog. Romantischen Oper.
Was sonst noch zu lesen ist, ist sozusagen Landschaft – am Ort und im Werk. Romy Donath beschreibt die beiden Ferien- und Arbeitsorte Hosterwitz und Graupa in Bezug auf die beiden berühmten Gäste, Georg Högl bietet eine Art Zusammenfassung einiger Passagen aus seinem großen Buch zu Weber, Wagner und dem deutschen Wald, indem er Wagners Freischütz-Aufsätze unter die philologische Lupe nimmt, und Manuel Gervink beschreibt schließlich in wünschenswerter Ausführlichkeit die schließlich erfolgreichen Bemühungen um die Überführung der sterblichen Überreste C.M. von Webers seit seinem Tod; klar wird, dass Wagner auf einen stehengebliebenen Zug aufsprang, um ihn mit einigen anderen Männer wieder zum Fahren zu bringen. Was nationalpatriotisch intendiert war, was für den Kapellmeister und Operntheoretiker Wagner selbst dabei heraussprang und wie gewunden die Wege zwischen Huldigung und Kritik an einer inzwischen „alten“ Oper waren: das macht Gervinks Beitrag über alle lokalpatriotischen Interessen der Vergangenheit und der Gegenwart hinaus klar.
Weber, ein Wegbereiter? Jein – denn so wie Wagner sich selbst erfinden musste, ohne auf die Errungenschaften der Vorlebenden zu verzichten, so sehr muss Webers Werk als eigenständiger Beitrag zur Oper geschätzt werden. Die „prüfende Neusichtung“, von der die Herausgeberin und der Herausgeber im Vorwort sprechen, ist wirklich eine, „die die Einsicht kritischer Forschung im Bewusstsein führt, die sich im Eifer der Dekonstruktion aber der Fahndung nach positiven Belegen nicht verschließt“. Ein Lob also für die Veranstalter und Autoren des „kleinen“, aber wertvollen Symposions und Tagungsbandes.
Frank Piontek, 1. Februar 2025
Carl Maria von Weber als Wegbereiter Richard Wagners?
Hrg. von Romy Donath und Wolfgang Mende.
111 Seiten.
Donatus Verlag, Niederjahna 2025
