2022 erschien das Buch in Paris unter dem Titel „Mémoires“. Als Autoren wurden Josephine Baker und Marcel Sauvage genannt. Der französische Journalist und Schriftsteller hat diese Memoiren der Josephine Baker, die nun erstmals in deutscher Übersetzung (von Sabine Reinhardus und Elsbeth Ranke) erschienen sind, in mehreren Teilen und großen zeitlichen Abständen geschrieben. Es ist keine fortlaufende Erzählung, eher einer Art Reportage, die in mehreren Unterhaltungen über zwanzig Jahre hinweg stattgefunden hat. Aber eine, die es in sich hat in zehn Kapitel und allerhand Auskunft gibt über die Vita, das Privatleben, die schillernde Persönlichkeit und die einzigartige Karriere der legendären Sängerin Tänzerin, Schauspielerin und politischen Aktivistin. Immerhin gehörte sie im Zweiten Weltkrieg der Résistance und den Streitkräften des Freien Frankreich an.
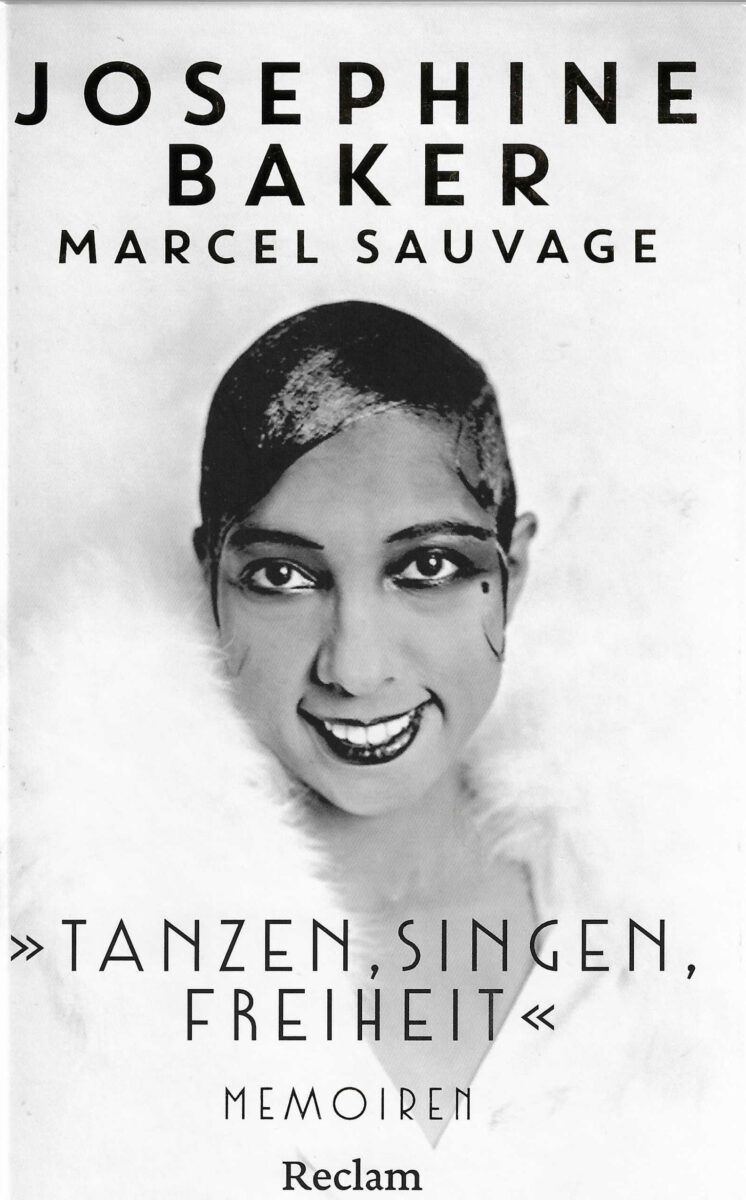
Im ersten Kapitel schildert Josephine Baker ihre bitterarme Kindheit in St. Louis. Sie hatte nicht einmal Strümpfe und ihr war immerzu kalt, Dort wurde sie 1906 geboren, als uneheliches Kind einer schwarzen Waschfrau und eines jüdischen Schlagzeugers, der sich bald nach der Geburt aus dem Staub machte. Dort musste sie schon mit acht Jahren als Dienstmädchen arbeiten, erlebte mit elf einen der schlimmsten Pogrome gegen Schwarze in der US-Geschichte, wurde mit dreizehn zwangsverheiratet. Man erfährt einiges über ihre Leidenschaft fürs Theater, warum sie Tänzerin wurde und mit acht Jahren die Schule verließ, sie schildert ihre übergroße Tierliebe, ihre Liebe zu Farben und ihr Debüt in einem kleinen Theater in Philadelphia, wo sie in einer schäbigen Revue auftrat und kaum Geld verdiente und daher ständig Hunger hatte. Sie machte sich auf den Weg nach New York, wo sie in einen Theaterdirektor mit geradezu aufdringlichen Anfragen derart auf die Nerven ging, bis er sie schließlich engagierte, allerdings nur für die zweite Truppe des Hauses und für ein sechsmonatige Tournee.“ Du spielst und tanzt wie ein Affe“, musste sie sich anhören. Es war abwertend gemeint, wurde aber später zum Markenzeichen des Stars.
1925 Wagte sie den Sprung über den Atlantik. Sie fuhr mit dem Schiff nach Europa. Ihr Ziel war Paris. Sie liebe den Trubel und die Geheimnisse von Paris, den Champagner, den Lärm, die Mode, den Schmuck, die Geschenke. Sie ist oft umgezogen, von Arrondissement zu Arrondissement. Paris wurde zu ihrem „Urwald“, wie sie bekannte, in dem sie herumtollte.
Im zweiten Kapitel erfährt man schon von ihrer ersten Probe in der „Revue Nègres“ im Théâtre des Champs-Elysees, wo alle Mitarbeiter Kopf standen ob Ihres Talents. Der Charleston hatte Besitz von ihr ergriffen und alle, die ihr zuschauten, wurden infiziert. Sie wurde zu einer Ikone des Charleston. „Die Europäer haben den Charleston durch die Schwarzen kennengelernt. Sie haben daraus einen anderen Tanz gemacht, der nicht viel mit dem ursprünglichen Charleston zu tun hat, aber trotzdem sehr gut ist. Wer Charleston tanzt, muss dazu eine Muschelkette tragen, die auf der Haut scheuert und rasselt und eine trocken klingende Musik erzeugt. Ich habe die Muschelkette durch Bananen oder Federn ersetzt.“
„Als Star der aus Paris importierten „Revue Nègre“ war sie in der Silvesternacht 1925/26 erstmals in der deutschen Hauptstadt zu sehen. Mit entblößter Brust, am Leib wenig mehr als ein paar blaue und rote Federn, wirbelte Baker über die Bühne. Sie grimassierte, schielte, ließ ihr Becken kreisen. Mal stolzierte sie auf allen vieren, mal fiel sie in einen rasanten Charleston. Und wackelte so virtuos mit dem Hintern, dass die Zuschauer in Ekstase gerieten. Und der deutschnationale Journalist Adolf Stein über ‚dieses ganze Höllengelichter aus dem Urwald‘: ‚Die Füße trillern wie verrückt. Der Bauch zuckt im Vierundsechzigsteltempo und schnappt nach den Hüften. Der federgeschmückte Steiß hat sich selbständig gemacht und rotiert rasend wie Feuerwerk‘ Das Phänomen Josephine Baker inspirierte deutsche Kritiker zu tierischen Vergleichen. Adolf Stein verglich sie mit einer Ente, ein Journalist der ‚Berliner Börsenzeitung‘ mit einem Känguru und Fred Hildenbrandt, Feuilletonchef des ‚Berliner Tageblatts‘, mit einem ‚dunkelhäutigen Kolibri‘.“, so las man im „Spiegel“. Die Baker wurde als exotisches Tier stilisiert, das koloniale Sehnsüchte der Europäer nach Sinnlichkeit und Sex, nach Urwald und Exotik zu bedienen schien. Ab 1926 schnallte sich Josephine Baker ab den berühmten Gürtel aus 16 Bananen um die Hüften, Über Nacht war aus dem schlanken Mädchen der erste schwarze Superstar geworden. Ein Sexsymbol, das wie kein zweites das Sinnbild der vergnügungssüchtigen wilden Zwanziger verkörperte. Und in Berlin den Nerv der Zeit traf.
Die Baker erzählt viel von ihren Zeitgenossen und Berufskollegen, Bewunderern, ihren Enttäuschungen und ihren vielen Liebeserfahrungen mit verschiedenen Männern und Ehemännern, ohne Groll oder Triumphgefühl, und immer diskret. Ihre größte Liebe galt allerdings schon früh den Kindern, den armen und einsamen Kindern. Sie wollte für diese Kinder „eine Weihnachtsfrau „sein, die die sie zu mit Geschenken überhäufte. Das war ihre Art von Liebesbezeugung. „Es gibt auf der Welt nichts Schöneres nichts Königlicheres als ein Kind, bekannte sie. „Für mich sind alle Kinder Könige und alle kleinen Mädchen Prinzessinnen.“ Weihnachten war für sie „das schönste Fest, die größte Freude aller kleinen Kinder. Ich denke an alle kleinen Menschen auf der Welt und an meine eigene Kindheit.
Im Grunde war sie selbst ein Leben lang ein großes Kind, ein wildes, unerzogenes, freiheitsliebendes, querköpfiges Kind.
Neben viel assoziativ hingeworfenen Anekdoten und naiv (kindlich) scheinenden Äußerungen lautete ihr Credo: „Ich tue, was mir passt“. In den folgenden Kapiteln beglaubigt sie das immer aufs Neue. Sie rühmt sich, dass sie schon in etwas mehr als zwei Jahren, von 1928-1930 „25 Länder in Europa und Amerika“ bereist habe. Sie war eine Reiseexistenz. Die Nomadin berichtet denn auch von den vielen Stationen ihrer Karriere. Von Land zu Land, mit eingestreuten Charakteristika der Menschen und Künstler., „jedes Land, das ein Reisender kennenlernt, erleuchtet und verändert ihn ein wenig – ob er es will oder nicht —, jedenfalls wenn er neuen Eindrücken gegenüber aufgeschlossen ist, Sinn für die rätselhafte Melodie einer Sprache hat und eine Seelenlandschaft, die ihm unbekannt ist.“
Marcel Sauvage erklärte sie: „Ein neues Land ist für mich zuallererst wie eine neue Musik, und wenn ich abreise, ist es wie ein Tanz, den ich tanzen möchte. … Mit jedem neuen europäischen Land, in das ich kam, habe ich gelernt, Frankreich im Vergleich besser zu verstehen, und die geheimnisvolle und wunderschöne Rolle von Paris“ …Pari war für sie der „Stern des Abendlandes, ein Stern, nicht wahr? Wie der Polarstern.“
Deutschland war das erste europäische Land, in das sie nach ihrem Debüt in Frankreich reiste. „Ich wurde begeistert empfangen. Hätte ich den Vertrag angenommen, den mir damals – 1926 – Max Reinhardt anbot, hätte ich vielleicht in Deutschland als Schauspielerin Karriere gemacht; doch mein Stern war der Himmel über Paris. Sie sagten mir, Monsieur Sauvage, Sie lieben Deutschland, das Land der Dichter, der Bierkeller, der Wundermaschinen. Aber haben Sie den deutschen Geist begriffen? Ich nicht. Deutschland ist das Land der Ordnung und des Lichts — Berlin ist nachts hundertmal so hell erleuchtet wie Paris -, und doch wohnt diesem Land der Ordnung und der Bequemlichkeit dauerhaft das Phantom des Suizids inne.“
Regisseur Max Reinhardt hatte der „schwarzen Venus“ tatsächlich ein Engagement am Deutschen Theater angeboten und wollte sie zur Schauspielerin aufbauen. Ihr gefiel die Idee zunächst gut. Doch dann legte das Varieté Folies Bergère 400 Francs mehr pro Vorstellung drauf, – und Baker entschwand an die Seine. Zum Glück. Denn bald wehte in Deutschland, und nicht nur dort, ein ganz anderer Wind. Ihre Erinnerungen an das alte Berlin sind lesenswert.
Die Baker – erfolgsgewohnt, aber nicht erfolgsverwöhnt- bekennt: Ihre Kindheitsgeschichten waren „erfüllt von Friedhofsgeschichten…eine Schwarze Kindheit ist immer ein bisschen traurig“. Man darf nicht vergessen, sie war einer der ersten schwarzen Stars. Die oft unverhohlen rassistischen Kommentare der Kritiker nahm die Baker, die später an der Seite von Martin Luther King gegen Diskriminierung kämpfte, nicht leicht.
„Ich bin schwarz, aber ich bin Französin“, sagte die Tänzerin, die acht Jahre später die französische Staatsbürgerschaft annahm, in einem Interview, „es ist mein Land.“ Und: „das einzige, wo ein Mensch in Frieden leben kann“.
Ein weitverbreitetes Motto des Rassismus in den Nachkriegs-USA lautete: „No jews, no dogs, no niggers“ „Im Jahr 1948, nach dem Krieg und seinen nie dagewesenen Grausamkeiten, nach so viel Elend, Marcel, da zerreißt einem dieser Spruch das Herz. Und er versetzt mich in Wut.“ Doch ihre Wut richtet sich auch gegen die Juden.
„Ist es mein Fehler, dass mir dieser Satz, diese drei grausamen Worte, die ich so oft, und sogar in New York, von anständigen Menschen hörte, keine Ruhe lassen? Sind wir für diese anständigen Amerikaner nichts weiter als Wanzen? Sind wir denn aus eigenem Antrieb übers Wasser zu ihnen gelaufen?… In Harlem haben Juden die Schwarzen zu Sklaven gemacht. Alle Häuser dort sind in den Händen jüdischer Eigentümer. Sie unterdrücken die Schwarzen. In allen Kinos, allen Supermärkten in Harlem arbeiten schwarze Angestellte, und sie werden ausgebeutet wie nirgendwo sonst. Ohne Juden finden Schwarze keine Arbeit. Ohne einen jüdischen Mittelsmann stellt sie niemand am Broadway ein. … Ich frage mich, ob den Juden nicht klar ist, was sie da eigentlich tun? Und warum sie es tun? Sind sie wirklich aus allen Ecken der Welt hierhergekommen, um sich so zu verhalten? Darf man ihnen da noch Glauben schenken, wenn sie sich darüber beschweren, dass andere Menschen sie anklagen?“
Ihre Empörung über Amerika kannte keine Grenzen. Dabei bestätigt sie den USA „das Beste und das Schlechteste und dazu viel Ahnungslosigkeit. In dieser Nation der Selfmademen gilt nach wie vor Rockefeller, der als Zeitungsjunge anfing und sich dann Cent für Cent zum Milliardär hocharbeitete, als das große Vorbild….Aber wenn die Menschen nach und nach. mit dem Erfolg, dem Geld, der Macht und der Eitelkeit, nicht mehr auf die Stimme ihres Herzens hören, tötet diese Arbeit ihre Seele. Die Sprache des Herzens verstummt. … Und ihre Welt zu einer, in der ausschließlich das Geld zählt. … Die Amerikaner haben keine Zeit zum Nachdenken. Sie arbeiten, studieren, produzieren, amüsieren sich folgsam. Nein, zum Nachdenken sind sie zu beschäftigt.“ Ist das heute anders, fragt sich der Leser?
Neben ihrer Karriere und ihren politischen Bekenntnissen spielt aber auch das Private keine geringe Rolle in diesem Buch. In Kapitel 5 rühmt sie sich des Kochens. „Ich habe einen unstillbaren Appetit. Mein Lieblingsessen sind Spaghetti mit einer Schicht rotem Pfeffer. Italienische Spaghetti, über denen ich eine halbe Stunde lang die Pfeffermühle schwenke. Ich liebe das. Ich kenne mich damit aus, ich bin eine gute Köchin. Oft koche ich abends für meine Freunde. Und ich backe hervorragenden Kuchen…. Meine Spezialgerichte sind gefüllte Bagels, Huhn in Sahnesauce, Früchtetarte, Kaviarpfannkuchen, Kaninchen-Confit und Makkaroni Napoli.“
Erschütternd sind ihre Berichte über ihre Zeit in den Kriegsjahren zwischen 1939 und 1945. Marseilles, Marrakesch und die Wüste werden wichtige Stationen. Baker wurde sehr krank. „In diesen Jahren habe ich zu oft Bekanntschaft mit dem Skalpell gemacht, mit Krankenhäusern, durchwachten Nichten, Fieber. Ich hörte den Muezzin jedes Mal, wenn er zum Gebet rief. Für mich sind die Muslime näher bei Gott. Sie haben für mich gebetet. Ich habe überlebt.“
Ihr Rückzugsort und Refugium wurde schließlich das Schloss Les Milandes, das sie kaufte. Es1iegt in der Dordogne bei Sarlat, in Castelnaud-Fayrac. Josephine Baker gründete auf ihrem Schloss eine Familie mit Kindern aus unterschiedlichen Ländern, Religionen und Hautfarben. Sie sprach immer von ihrer „Regenbogenfamilie“, die sie beispielhaft der Welt vorführte (die allerdings später verfiel, auch das Schloss (und ihr ganzes Geld) verlor sie, aber das ist nicht Teil ihrer quasi Auto-Biographie).
Nach dem Krieg kümmerte sich die Baker zunächst um die ARMEN IN Paris; und sie startete nach dem Frieden eine neue Karriere. Trotz aller Berühmtheit war sie frei Von Starallüren oder exaltierter Eitelkeit. „Selbst wenn ich im Alter noch mal in Armut leben müsste, sowie in meiner Kindheit, würde ich niemals die Geheimnisse meines Herzens preisgeben.“
„Es mag ja zutreffen, dass ich, was die Art und Weise betrifft, in der ich mein Leben führe und Dinge verstehe, dem kleinen schwarzen Mädchen von früher ähnlich bin. Das haben die Leute oft zu mir gesagt. Jetzt werfen sie mir vor, dass ich mich verhülle, mich verstecke. Sollen sie doch. Man lasse mir die Schamhaftigkeit der Wilden. Sie hat etwas Erhebendes und ist der einzige persönliche Schatz, den einem niemand nehmen kann, so wie der eigene Kummer, denn es ist ja unnütz, damit andere Menschen zu belasten, die ihre eigenen Nöte haben, nicht wahr?“
Am Ende der lesenswerten und human timbrierten Memoiren des unvergleichlichen schwarzen Stars der wilden Zwanzigerjahre, der geradezu zur Ikone des Antirassismus wurde, und mit höchsten Ehren und Auszeichnungen über häuft wurde (Für ihre Verdienste erhielt Baker 1957 das Croix de Guerre und wurde gleichzeitig in die Ehrenlegion aufgenommen. Die offizielle Verleihungszeremonie erfolgte 1961 durch den ehemaligen Chef der französischen Luftwaffe. Daneben wurde Baker bereits 1946 mit der Médaille de la Résistance ausgezeichnet, zuletzt besaß sie außerdem zwei weitere Gedenkmedaillen für ehemalige Kriegsteilnehmer), am Ende dieser Ausnahme- Memoiren liest man „Leben ist tanzen, ich würde gern außer Atem sterben, am Ende eines Tanzes oder eines Refrains -allerdings nicht in einem Varietétheater. Ich habe dieses künstliche Leben satt, das grelle Scheinwerferlicht. Als Bühnenstar habe ich mich niemals wohlgefühlt. Inzwischen gefällt es mir überhaupt nicht mehr…. Meine Seele ist davon schon richtig gebeutelt. Es reicht. Ich werde mich im Süden Frankreichs niederlassen und in Les Milandes wohnen. Dort möchte ich in Frieden leben, mit meinem Mann, meiner Familie, meinen Erinnerungen, unter Kindern und Tieren.“ Sie sprach von ihrer „Regebogenfamilie“. Und mein letzter Wunsch, Marcel, mein Dichter, schreiben Sie ihn auf: Ich möchte zu einer Fee werden, das wäre mein Herzenswunsch, zu einer guten Fee inmitten eines kleinen französischen Dorfes.“ Er hat es aufgeschrieben und er hat eine bezaubernde, authentische anmutende Biografie einer ungewöhnlichen Frau aufgeschrieben, die zu lesen sich lohnt.
Dieter David Scholz, 29. März 2025
Josephine Baker/Marcel Sauvage: „Tanzen, Singen Freiheit“
Reclam Verlag
281 S., 26,00Euro
