Franz Mrazek, Toni Petzer, Josephine Maier – schon mal gehört? Nicht? Dabei gehören die drei Personen in den unmittelbaren Umkreis Richard Wagners. Zugegeben: die Mrazeks, also Franz und Anna, sind noch am bekanntesten, da Wagner das Dienerpaar sehr schätzte und viele Briefe des Komponisten an die Beiden überliefert wurden. Josephine Meier könnte dem Wagner-Kenner ein Begriff sein, war sie doch die Mutter Mathilde Maiers, eines Wagnerschen „Gspusis“, wie man altbayerisch sagen könnte. Aber Toni Petzer? In gewisser Weise schrieb Toni Petzer Operngeschichte, da er den Fasolt in der Uraufführung des Rheingold sang.
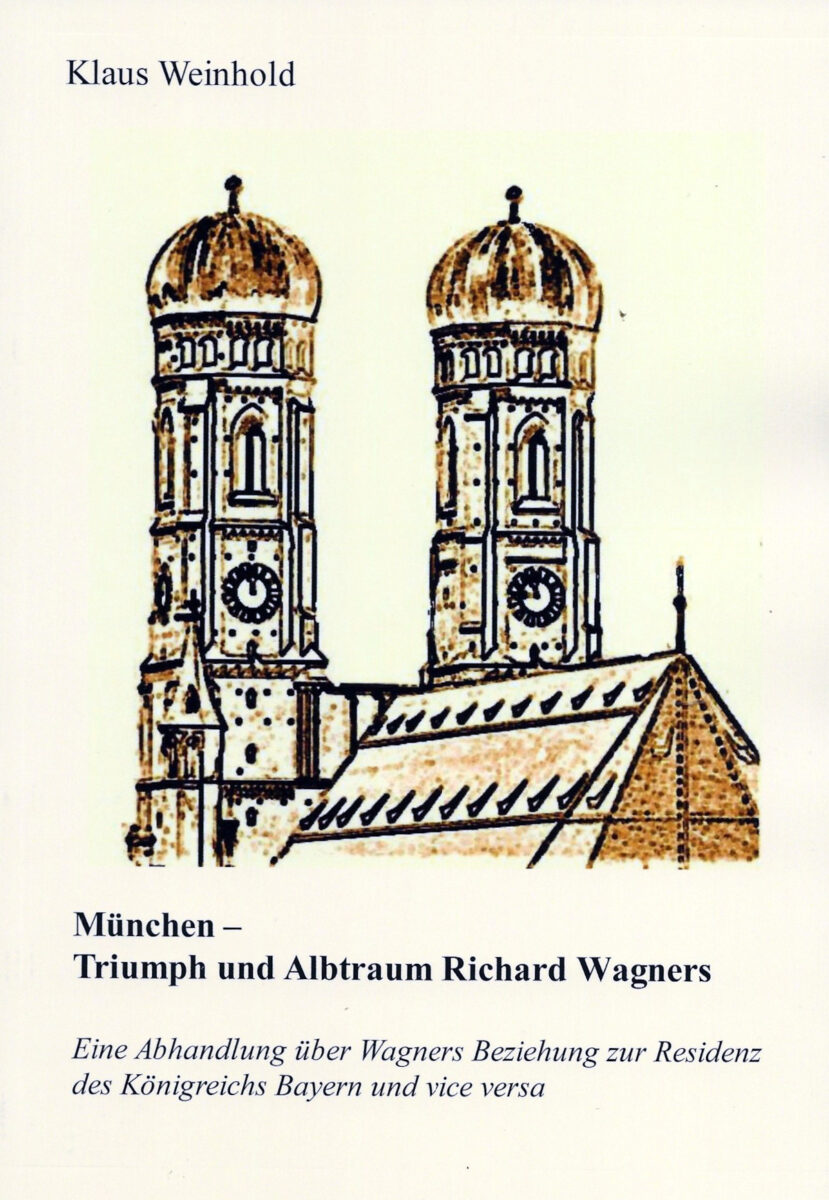
Der „Vorabend“ der Tetralogie aber wurde nicht in Bayreuth, sondern in München aus der Taufe gehoben – einer schönen Stadt im Voralpenland, die für Wagner zugleich „Triumph und Albtraum“ war. So verheisst es der Untertitel einer neuen Druckschrift über Wagners intensive Beziehungen zur Isarmetropole, die laut Autor nichts weiter will als jene Ereignisse zu beschreiben, die „hinlänglich bekannt“ seien und „oft publiziert“ worden sind. Nun ist es mit dem „Bekanntsein“ historischer Fakten und Daten so eine Sache. Wer kennt schon Sebastian Röckls nach wie vor einschlägigen, 1903 und 1920 erstmals publizierten Doppelband über Wagner und „seinen“ König oder die letzten Symposionsbände und Ausstellungskataloge zum Thema? Oder gar den Huldigungsmarsch für Ludwig II. in der für die Blechbläser gesetzten Originalfassung? Um es mit Beckmesser zu sagen: „Da seid ihr nun wieder zu bescheiden.“ Denn Klaus Weinhold, Vorsitzender des Dresdner Wagner-Verbandes, hat mit seinem neuen Buch ein Werk vorgelegt, das zwar für den Kenner, der noch neue Wagner-Bücher liest, wenig Neues enthält, aber auch für ihn das „Bekannte“ sinnvoll zusammenfasst – und in Bilder bringt, die es so noch in keinem Wagner-und-München-Buch gab.
Der Leser erfährt also alles Wesentliche über Wagners Berufung nach München, ohne dass sich der Autor in den Details der Ludwigschen und Wagnerschen Rechnungsführung verlieren würde. Weinhold ist ihm ein Cicerone durch Wagners sämtliche München-Aufenthalte, er erläutert kurz (es ist für einen Band genug) alle Tätigkeiten, die Wagner am Hof Ludwigs II. vollbrachte. Er wird bekanntgemacht mit ausnahmslos allen wichtigen und auch weniger wichtigen Persönlichkeiten, mit denen Wagner „Umgang pflegte“, wie es früher so schön hieß. Er informiert über sämtliche Häuser, Wohnstätten, Hotels und Adressen, an denen Wagner und seine Freunde und Bekannten (von Carl Bechstein bis Friedrich von Ziegler), auch die Sänger und Sängerinnen der Münchner Uraufführungen (von Kaspar Bausewein bis Ludwig Zottmayr), seinerzeit zu finden waren. Der Anhang listet alle diese Herr- und Frauschaften auf und benennt ihre Profession. Eine Folge von Kurzporträts von 39 ausgewählten Münchner Stätten, die mit Wagner meist zu tun hatten, rundet die Tour ab. Den Schluss des Buchs aber macht der beigelegte historische Faltstadtplan, in dem man die wesentlichen Orte markiert findet, in denen sich Wagner und die Seinen, die Bülows, Carl Spitzweg und Franz Lenbach einst aufhielten. Wir erfahren, in welchen Caféhäusern und Gasthäusern Wagner und seine Bekannten den dunklen und den hellen Saft genossen. Man erfährt, dass der Augustiner und der dazugehörige Keller westlich des Hauptbahnhofs Kern-Orte der wagerianischen wie der antiwagnerschen Münchner Bierseligkeit waren, übrigens auch heute noch sind. Weinhold erläutert natürlich auch das Projekt eines Münchner Wagner-Festspielhauses. Nur in einem Punkt muss man ihm widersprechen: mag auch das Theater eine „Bereicherung und Prunkstück für München“ geworden sein, kann man bezweifeln, dass der Hofgarten durch den Durchstich einer zentralen, die Einheit des Geländes zerstörenden Achse an Wert und Schönheit gewonnen hätte. Abgesehen davon, dass man damit Ludwigs I. Hofgartenarkaden demoliert hätte – wo würden heute die Boule-Spieler sich vergnügen?
Weinhold führt uns jedoch nicht allein an die populären Wagner-Orte, also in die (kriegszerstörte) Villa an der Brienner Straße und die Hofoper, an den Starnberger See und den nicht mehr existierenden Glaspalast. Für all die, die auch die unmittelbare Umgebung Münchens lieben, ist die Fahrt nach Großhesselohe interessant, also nach Pullach und an die Isar. Man kann sich also mit Weinholds Buch (und Stadtplan) in der Hand auf eine Wanderreise in die Münchner Kulturgeschichte begeben, wobei die meisten Wagner-Orte längst nicht mehr existieren. Dies gilt seit wenigen Wochen auch für das Lieblingshotel der Wagners, das von je her als Künstlerhotel bekannte Hotel Marienbad in der Barer Straße 11b, deren Pächter zur Zeit der Drucklegung des Buchs im Dezember 2024 nach 50 Jahren vom Vermieter, dem Freistaat Bayern, die Kündigung erhielten, weil man aus dem ehemaligen Hotel ein Wohnobjekt für Staatsbedienstete machen will. Soviel zur Münchner Traditionspflege. Wir erfahren, dass Wagner und seine Familie hier sechsmal quartierten – hätten Sie’s gewusst?
Und ist das alles wichtig: zu wissen, wo wer wann wohnte und dort oder im Wirtshaus den Komponisten traf? Da bei Genies nun mal alles von Bedeutung ist und/oder zumindest interessant, weil es die Aura eines Orts bedeutend verstärkt, ist alles betrachtenswert. So verbindet sich bei Weinhold die Münchner Kultur- und Einwohnergeschichte zwanglos mit der Wagner-Biographie, wobei das Werk nicht außen vorbleibt. Der Anhang listet nicht allein sämtliche großen und kleineren Schriften auf, die Wagner in der Münchner Zeit schrieb, auch sämtliche Kompositionen und Kompositionsetappen auf dem Weg zur Vollendung des Siegfried und der Meistersinger. Dass Wagner in München nicht nur neue Anschaffungen und sich neue Feinde machte, ist ja bekannt; dass er quasi „nebenbei“ wenigstens einige Takte des ersten Meistersinger-Akts schrieb und die Instrumentation des zweiten Siegfried-Akts fertigstellte, dürfte vor Allem denen ein Begriff sein, die das Wagner-Werk-Verzeichnis unter dem Kopfkissen zu liegen haben.
Also: Weinhold hat tatsächlich ein reich bebildertes wie informatives, mit sinnreichen und ausführlichen Anhängen versehenes Buch vorgelegt, das in der vorliegenden Wagner/München-Literatur eine Lücke schließt: für Münchner und für alle, die die Stadt schätzen, aber auch für jene Wagner-Freunde, die der Abstraktion der Theorie die Praxis des gelebten Lebens und den genius loci zur Seite stellen wollen. Dass Wagner heute nicht in der Münchner Ruhmeshalle vertreten ist, mag auf einem Versehen beruhen, auch wenn wir die Büste des Künstlers in der Walhalla, also im anderen großen Pantheon Ludwigs I., finden. Sein Münchner Denkmal zwischen zwei Buchdeckeln zu vereinigen: Das ist Weinhold nun liebevoll gelungen.
Frank Piontek, 5. Februar 2025
Klaus Weinhold: München
Triumph und Albtraum Richard Wagners.
Eine Abhandlung über Wagnes Beziehung zur Residenz des Königreichs Bayern und vice versa.
Privatdruck, Dresden 2024. 185 Seiten, 155 meist farbige Abbildungen, mit Faltstadtplan.
Preis: 14,50 plus Postgebühren. Bestellung bei: kw.rwv.dresden@mail.de.
