Wagner und Russland – man wird nicht behaupten können, dass dieses Thema von den Wagnerforschern unbelichtet geblieben ist. Und doch muss man sich als des Russischen unkundiger Leser die Informationen, die das beiderseitige Verhältnis betreffen, intensiv heraussuchen, wenn man sich nicht darauf beschränkt, die relativ wenigen deutschen Publikationen zum Thema zu studieren.
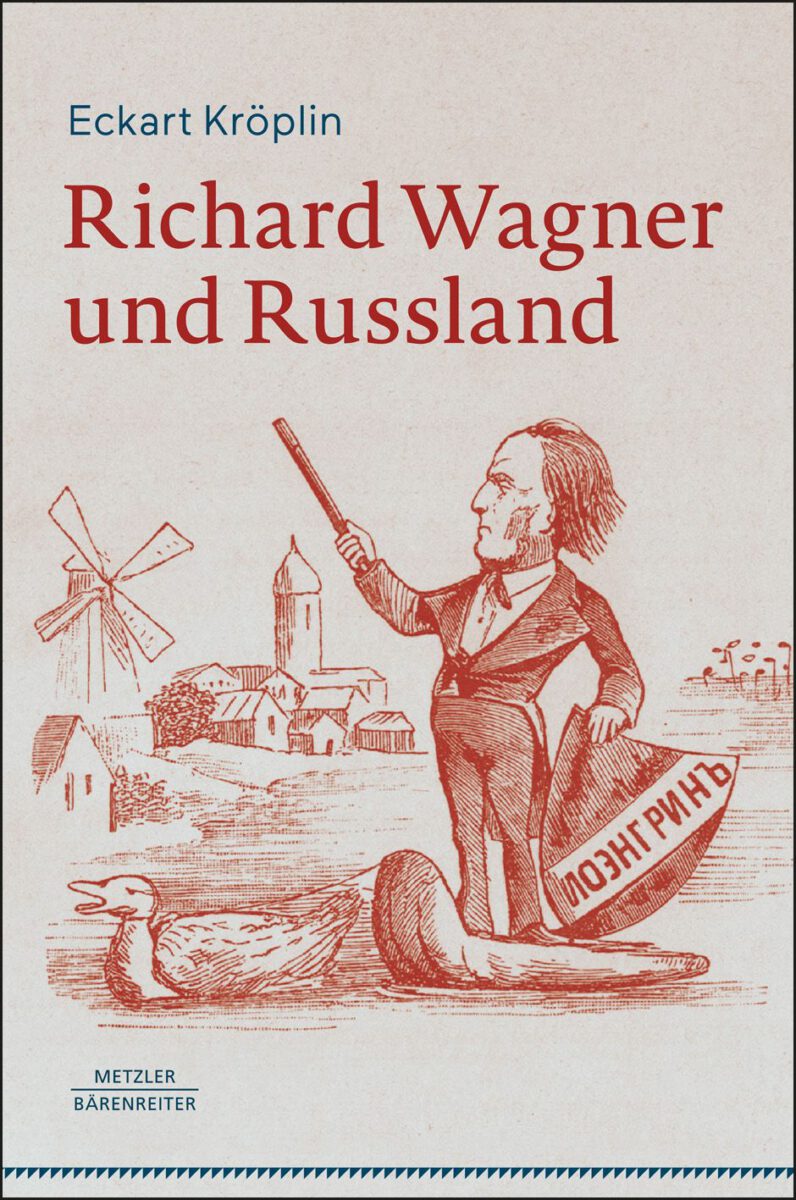
Eckart Kröplin kann Beides: deutsch und russisch, also kann er nicht allein Abram V. Gosenpuds Richard Wagner i russkaja kultura von 1990 lesen. Außerdem kennt er die einschlägige englische Literatur, allem voran Rosamund Bartletts Wagner and Russia von 1995. Insofern ist das Buch, das er nun unter dem konzisen Titel Richard Wagner und Russland vorgelegt hat, eine wertvolle Ergänzung: zum einen in Bezug auf Wagner, zum anderen in Bezug auf die Wirkung, die Wagner und seine Werke in Russland und der Sowjetunion erfuhren. Er habe, schreibt der Autor, den „Handlungsrahmen“ der bereits vorliegenden Literatur „erweitert“; heraus kam ein Panorama, das die bereits behandelten Aspekte beträchtlich erweiterte und vertiefte. Dass schon der kleine Richard als „Kosak“ bezeichnet wurde, ist also mehr als eine hübsche Pointe. Es war der Beginn einer mal mehr, mal weniger starken Auseinandersetzung mit dem russischen Riesen, der sich seinerseits intensiv mit Wagner beschäftigte – und dies weit mehr, als man bisher, zumindest bei uns, wusste. Noch bis zuletzt befand sich in Wagners unmittelbarer Umgebung ein Russe: Paul Joukowski, der am Bühnenbild des Parsifal mitgearbeitet hatte und die Wagners nach Venedig begleitet hat. Bedenkt man, dass Wagners Schwager Avenarius in Moskau eine Filiale seines Buchhändlergeschäfts gegründet hatte, und erfährt man von Neuem, dass seinerzeit in Russland viele Deutsche lebten, begreift man auch, dass die kulturellen Beziehungen zwischen den deutschen Ländern und Russland der ideale Nährboden für die Einladung Wagners an die Newa waren, nachdem Wagner, im russischen Riga lebend und daraus über die russische Grenze fliehend, ganz andere Erfahrungen mit einem Volk gemacht hatte, das im Westen, politisch gesehen, vor Allem als Unterdrücker der Polen bekannt war.
Natürlich beschreibt Kröplin, immer mit den nötigen Seitenblicken auf die russische Geschichte, die enge Beziehung zwischen Wagner und dem Berufsrevolutionär Michail Bakunin, aber Bakunin, für Wagner ein „wilder, vornehmer Kerl“, war nicht der einzige bedeutende Russe, der sich mit Wagner befasst hat. Als man sich in Dresden traf, lag die Erstveröffentlichung eines Wagner-Texts ins Russische übrigens schon acht Jahre zurück: Einer jener Funde, für den man dem Autor nur dankbar sein kann. Kröplin erzählt die Geschichte der Wagner-Aufführungen in Russland, genauer: in Pawlowsk bei Petersburg,wo die Wiener Strauss-Kapelle bereits 1856 Stücke zur Erstaufführung brachte und Tannhäuser und Lohengrin so beliebt wie umstritten waren. Der fliegende Holländer hat seltsamerweise nie die Popularität bei den Russen erlangt wie bei uns, auch wenn sich Andrei Bely in seinem ingeniösen Petersburg-Roman, was Kröplin merkwürdigerweise nicht erwähnt, auf die Figur des verdammten Seefahrers bezog. Als Dmitri Tschernjakow 2021 in Bayreuth den Fliegenden Holländer inszenierte, bezog er sich ausdrücklich auf Belys Roman – auch so kann eine russische Wagner-Wirkung et vice versa aussehen.
Schwer umstritten war zunächst auch der Komponist der Opern. Der einzige, der, gegen Alexander Ulybyschews unsinnige Angriffe auf die nicht von Mozart komponierte Musik, vehement für Wagner eintrat, war Alexander Serow, der als Vermittler zwischen Wagner und Russland fungierte, Wagner auch mehrmals traf: nicht allein während Wagners Konzertreise an die Newa und die Moskwa. Schon früh wurde klar, dass es bei Wagner nicht allein um Kunst ging. Man begriff durchaus, dass die kunstpolitischen und revolutionären Traktate des Deutschen zu seinem Werk gehören. Dass die bedeutendsten Musiker Wagners Musik als Erzeugnisse eines wenn auch genialen oder wenigstens genialischen Irrläufers ansahen, so wie für den radikal intoleranten Leo Tolstoi alle moderne Kunst vom Teufel war, war nicht ungewöhnlich, auch wenn man heute nur noch schwer nachvollziehen kann, wieso Tannhäuser und Lohengrin viele Musikfreunde zum Urteil brachten, dass Wagner ein Nichtskönner, ohne Melodie und Rhythmus, sei. Wenn Wagner gelobt wurde, dann zumeist als Dirigent, nicht als Komponist.
Doch fielen gerade Wagners Texte in Russland auf fruchtbaren Boden. Kröplin zeigt, dass der Einfluss, den Wagner auf die russische Intelligenz hatte, nicht allein seinen genialen Werken zu verdanken ist, ja: Bisweilen hat man – aber das deckt sich mit westeuropäischen Beobachtungen – , den Eindruck, dass es beim größeren Teil der intellektuellen Wagner-Rezeption nicht um die Opern, sondern um Wagners theoretische Ideen und jene Impulse ging, die sein publizistisches Werk bei den Dichtern, Malern und Denkern auslöste. Auch in Russland verselbständigte sich – Kröplin schreibt das nicht ausdrücklich, aber es ist klar – die Wagner-Wirkung, oder anders: Jeder konnte sich seinen Wagner aus den Trümmern basteln, die er aus den Schriften und dem Faszinosum eines Ringes oder Lohengrin herausholte. Es waren, kein Zufall, um 1900 vor Allem die Symbolisten, die Wagners spezifische Mythologisierung alter Stoffe aufgriffen, um eine Vision eines neuen Russlands zu entwickeln (nb: in einer Werkliste werden zu viele Namen in den symbolistischen Topf geworfen, denn man kann durchaus darüber streiten, ob Strawinskys Sacre du printemps ebenso hineingehört wie Schönbergs Verklärte Nacht und Strauss’ Also sprach Zarathustra). Die „russische Idee“ wurde somit wesentlich von Wagner, genauer: von den Wagner-Interpretationen der Lyriker, Visionäre und sonst wie an der schnöden Gegenwart Leidenden bestimmt. Dass Wagner noch wenige Jahre zuvor, wenn überhaupt, als Symphoniker, aber nicht als Opernkomponist geschätzt wurde, als der er nach Meinung vieler Musikfreunde vollkommen versagt hatte – eine Charakterisierung, die sich wie ein Leitmotiv durch die frühe russische Wagner-Rezeption zieht –, war genauso einseitig wie die spätere Instrumentalisierung des Wagners der Revolutionsjahre. Andererseits verzeichnete man, woran der an sich scharfsinnige und gebildete Kulturkommissar Anatoli Lunatscharski schuld war, während der Stalinzeit Wagner derart, dass er nun in einen frühen revolutionären und späten reaktionären Künstler aufgeteilt wurde. Es sollte bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion dauern, bis dieses falsche Geschichtsbild revidiert werden konnte, auch wenn schon um 1970 herum ein Versuch gemacht wurde, Wagner als konsequenter Persönlichkeit gerecht zu werden. Freilich muss man sich über Verzeichnungen und Verurteilungen nicht wundern: wenn man weiß, dass der Schriftsteller Wladimir Odojewski, der bei Wagner einen starken, wenn auch nicht traditionellen Melodienreichtum entdeckte, Wagner besser und genauer hörte als der Musiker Tschaikowsky, der Wagner für einen miserablen Bühnenkomponisten hielt, wird klar, dass man es bei den von Kröplin interpretierten russischen Stimmen um höchst subjektive, im Einzelnen hellsichtige wie faszinierend negative Einschätzungen handelt. Dass Wagner bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts großen Einfluss auf die russische Kultur hatte, steht außer Zweifel; selbst bei Mussorgsky, der Wagner offiziell ablehnte, finden sich, wie bei Tschaikowsky, Spuren des Einflusses von Wagners Musik, bevor Dmitri Schostakowitsch, der Wagner wohl v. A. aus ethischen Gründen kritisch gegenüberstand, nicht umhinkonnte, die Musik des Älteren noch ganz zum Schluss in seinen Werken zu zitieren. Es muss auch auffallen, dass unter den großen Dichtern und Publizisten, die Kröplin genauer beschreibt, sich kaum einer zu Wagner bekannte. Selten genug, dass Iwan Turgenjew das Meistersinger-Vorspiel lobte, aber die Musik des Parsifal als „Katzenjammer“ empfand, so wie Alexander Borodin, der seine einzige Oper nie vollendete, und César Cui, dessen Opern im Orkus der Musikgeschichte verschwanden, ihren vermutlich auch ideologisch bedingten Unsinn des „Mächtigen Häufleins“ über Wagners Musik ausgossen. Alexander Herzen, Dostojewski und Tolstoi, der mit seiner Generalabrechnung aller moderner Kunst außer Konkurrenz agierte („Dies alles“, schrieb er über Wagners Musik, „ist so gauklerhaft, dass man sich wundert, wie Menschen, die älter sind als sieben Jahre, ernsthaft bei dieser Sache zugegen sein können“) – die ausgewählten Autoren blieben Wagner und dem russischen Wagner-Kult meist bewusst fern, aber nahmen den deutschen Komponisten und Schriftsteller doch so wahr, wie sie es kraft ihrer Profession und ihrer Interessen nicht anders konnten. Gerade diese Kapitel gehören zu den schönsten des Bandes, denn wer beherrscht schon das Russische und vermag in den originalsprachlichen Quellen zu lesen? Und wer hat schon im Gedächtnis, dass der Symbolist Lew Kobilinsky 1932 in den Bayreuther Blättern einen Aufsatz publizierte: natürlich über den Tempel des heiligen Grales als Dichtung und Wahrheit. Da verbündeten sich nicht zuletzt Mythos und ein Messianismus, den man als typisch russisch bezeichnen könnte, indem die „russische Idee“, befeuert von Wagner-Argumenten, nun ins Metaphysische, auch ins Missionarische ausgreifen konnte. In diesem Sinn – dies ist eine besondere Pointe, die man aus den Kröplinschen Untersuchungen ziehen kann – wären Wagners Ideen über Russland zurückgekehrt in sein Heimatland.
Umgekehrt hatte Wagner, wenn es nicht gerade um die Unterdrückung der Polen ging, durchaus ein zugewandtes Interesse an der russischen Kultur, wenn sie sich auch allein, aber immerhin, in der Lektüre russischer Romane (Tolstoi, Turgenjew) äußerte. „Germanen und Slawen – das geht“, schrieb er noch zwei Tage vor seinem Tod. Nach seinem Tod zeigten die synästhetisch begabten Komponisten Alexander Skrjabin und Konstantinas Čiiurlionis sowie die Dichter Andrei Bely und Alexander Block, wie Wagners Mystizismus für eine russische Kunst des Utopismus einer „unsichtbaren Kirche“ verwandelt werden konnte, während Wjatscheslaw Iwanow sich Gedanken über das Dionysische und den Tristan-Erotizismus in Wagners Kunst machte, die wiederum auf die Künstler wirkten. Es spricht für diese besonderen Wagner-Adaptionen, dass die Werke dieser Komponisten, Maler und Dichter auch heute noch hör-, anschau- und lesbar sind, auch wenn Kandinskys Aussagen zur „geistigen“ Kunst nur als Schwurbeleien bezeichnet werden können. So wirkte Wagner weiter als Initiator einer neuen Kunst und wurde gelegentlich als Durchgangsstadium zu einer futuristischen ars nova interpretiert. Kröplin macht nicht zuletzt darauf aufmerksam, dass vieles von dem, was Wagner in seinen Revolutionsschriften über das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft gesagt hatte, an die Thesen noch der Oktoberrevolutionäre Anschluss finden konnte. Wagner wurde plötzlich, nachdem man ihn erst bekämpft, dann in das Repertoire der bürgerlichen und kaiserlichen Theater aufgenommen hatte, für ein marxistisch sein sollendes Massenpublikum zum Revolutionsmusiker umfunktioniert – doch wer weiß: Vielleicht hätte Wagner, zumindest der Wagner des Jahres 1849, diese musikalische Volkstribun-Stelle eine Weile lang behagt…
Erst die mörderischen Aktionen Josef Stalins, denen auch der Theater- und Opernregisseur Wsewolod Meyerhold zum Opfer fiel, machten Schluss mit den Experimenten einer modernen Kunst, die sich direkt und indirekt auch auf Wagner berief. Meyerholds Tristan-Inszenierung war 1909 auf der Bühne des Petersburger Marientheaters für Russland ein coup, nachdem Gustav Mahler und Alfred Roller in Wien schon 1903 gezeigt hatten, wie eine wie auch immer symbolistisch verschlankte Wagnerbühne auszusehen hatte. Liest man Meyerholds eigene Aussagen zur Inszenierung, über die man sich, seien wir ehrlich, kaum einen wirklich genauen Eindruck verschaffen kann, da selbst die vielen überlieferten Dokumente nicht die reale Aufführung ersetzen können, bekommt man einen Einblick in die Art und Weise, wie ein moderner Opernregisseur zu Beginn des 20. Jahrhunderts an Wagner herangehen konnte: gestisch mit dem Stilmittel des die Musik verdoppelnden Micky-Mousing. Dass ohne Meyerhold „Jahrzehnte später das Neu-Bayreuth Wieland Wagners oder die Wagner-Inszenierungen von Robert Wilson oder Heiner Müller nicht denkbar gewesen seien“, ist jedoch eine zu steile These, als dass sie beweisbar wäre, wenn auch der Impuls, der vom Tristan von 1909 ausging, kaum zu leugnen ist.
Auch Sergei M. Eisensteins berühmte und vieldiskutierte Walküre-Inszenierung, die nach etlichen fast wagnerlosen Jahren auf der Bühne des Moskauer Bolschoi herauskam, um den Abschluss des Hitler-Stalin-Pakt zu begleiten, ist natürlich ein Kapitel wert. Kröplin beschreibt sehr genau, wie listig der Regisseur vorgehen musste, um seine Moderne, gegen den die deutschen Machthaber denn auch prompt protestierten, auf der Bühne durchzusetzen. Im Übrigen gilt die Moskauer Lohengrin-Aufnahme mit dem wunderbaren Ivan Koslowski und der tatsächlich „großartigen“ Elisaweta Schumskaja unter Kennern als eine der schönsten Lohengrin-Einspielungen: russisch, von Anno 1949. Da herrschte schon Eiszeit in Sachen „Russischer Wagner“, aber eine derartige Interpretation war damals durchaus noch möglich. Wer wissen will, welche Opern wann in Petersburg, Moskau und Riga ihre Erstaufführungen und späteren Inszenierungen bis in die Zeit nach der Sowjetunion erlebten, wobei Valeri Gergijew seinen Auftritt hat, findet im Übrigen bei Kröplin reichhaltige Listen; auch über einige der beliebtesten und charismatischsten Sängerinnen und Sänger wird Auskunft gegeben. Das Bildmaterial des umfangreichen Bandes bietet leider nichts Neues, aber da so gut wie kein deutscher Leser Rosamund Bartletts Fundamentalband von 1995 und etliche andere Bücher und Broschüren, Wagner und Russland betreffend, kennen dürfte, bietet die Bildstrecke einen auch optisch interessanten Einblick in eine kulturelle wie politische Beziehungsgeschichte, die als komplex zu bezeichnen nicht unterkomplex wäre.
Und Elisaweta Schumskajas Elsa klingt einfach nur vollkommen: in russischer Sprache.
Frank Piontek, 14. November 2025
Eckart Kröplin: Richard Wagner und Russland
Metzler / Bärenreiter
359 Seiten, 50 Abbildungen
