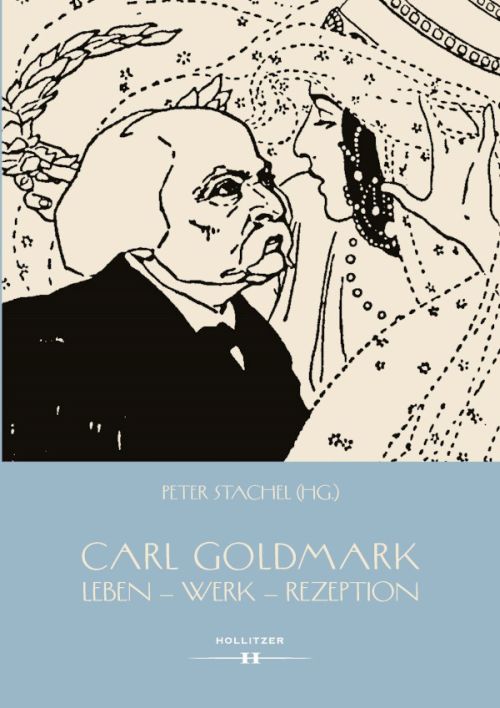
Sie wird selten gespielt: Die Königin von Saba. Dabei war das Werk, zumindest bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, eine der populärsten Opern, die je an der Wiener Oper gebracht worden sind. Dass sie das letzte Mal im Jahre 1937 am Hohen Haus und, soweit es Österreich betrifft, 1985 in Graz gespielt wurde, zieht natürlich die Frage (sie wird im anzuzeigenden Band gestellt) nach sich, wieso sich die Intendanten danach standhaft geweigert haben, der Dame aus dem Orient auf der Bühne an der Ringstraße Eintritt zu gewähren. Der Fall mag seltsam scheinen, wenn wir lesen, dass die Oper „gute, interessante und hörenswerte Musik“ aufweist – tatsächlich waren sich schon die kritischen Zeitgenossen darüber einig, dass sie zwar „schöne“, aber zugleich „zuviel“ Musik aufweise. Leser und Leserinnen, die mich und den seinerzeitigen Kritiker-Papst Eduard Hanslick und seine Marotten und notorischen Fehlurteile kennen, werden sich darüber wundern, wenn ich zugeben dass er recht hatte, als er der Oper jene Qualitäten absprach, die aus einem guten ein über die Zeiten hinweg spielbares Bühnen-Stück machen. Im Klartext: Dass die Königin von Saba heute kaum noch inszeniert wird – auch nicht in Wien, wo die Staatsoper sehr genau prüft, welche Stücke angesichts eines überschaubaren Premieren-Kontingents die (Wieder-)Aufführung lohnen –, dass sie also nach wie vor eine Rarität ist, hängt weniger mit der zweifellos über weite Strecken tatsächlich „schönen“ Musik zusammen. Es liegt wohl – die kritischen Zeitgenossen waren sich nicht zu Unrecht darüber einig – an der schleppenden Dramaturgie, am von heute aus betrachtet sprachlich banalen Libretto, an den Figurenzeichnungen (Salomo ist ein langweiliger Sarastro), zuletzt auch am sog. Orientalismus der Oper, der im Fall der Afrikanerin und der Aida, die seinerzeit naheliegenderweise mit der Königin von Saba verglichen wurden, allerdings wenig ins Gewicht fällt. Vielleicht liegt es nicht einmal an der Geschichte des schwachen Mannes zwischen der Frau, die man damals gern als „dämonisch“ diffamierte, und seiner anverlobten Sulamith, einem nicht sonderlich interessanten Wesen – zusammengenommen erinnert rein stofflich, nicht musikalisch (da überrascht einen sogar ein Vorklang eines prominenten zärtlichen Motivs aus dem Vorspiel des Rosenkavaliers, das vermutlich kein Zufall ist), zudem so viel an den Tannhäuser, dass man im Fall des Falles denn doch lieber zum wagnerschen Bühnenreißer als zur Saba-Oper greift, deren Schönheiten selbst dann in aparte, bisweilen dramatisch relevante, im Bühnentanz auf jeden Fall attraktive Einzelteile zerfällt, wenn man das gesamte Werk nach mehrmaligem Hören bis zum apotheotischen, harfenumkränzten Finale in seinen thematischen Groß- und Kleinformen begriffen hat. Und doch: Bisweilen blitzt da ein Ingenium auf, das es schade macht, sich die Königin immer nur durch einen Tonträger ins Haus zu holen. Bisweilen denkt der Hörer, der zwischendurch vergisst, dass Wagner vorher und Strauss später dramatisch wesentlich packendere Musikdramen verfertigt haben, dass es schade ist, dem Werk nicht wenigstens in einer gekürzten, die dramatischen Stränge verstärkenden Version live zu begegnen.
Der Fall Goldmark bleibt also so schwierig wie zu seiner Zeit, als sich die österreichischen und dann ungarischen Kritiker durchaus nicht einig darüber waren, wie viel das Werk nun Wagner, der ungarischen Musik oder gar irgendeinem Judentum in der Musik verdankt. Je nach politischer Couleur (und quer hindurch) konnte man das Werk als „jüdisch-orientalisch“ (auf deutsch: als jüdisch) verfemen oder als eigenständiges Opus würdigen; bei Eduard Hanslick, dem der Herausgeber Peter Stachel eine luzide Studie widmet, konnte im scheinbaren Lob einer „geistreichen“ und „technisch gut gemachten“ Musik allzu deutlich der schlimme Vorwurf verborgen sein, dass es der Komponist denn doch nicht mit den nichtjüdischen Komponisten aufnehmen könne. Erst 2019 hat Matthias Schmidt in einem herausragenden, Buch über Wagner, Hanslick und Goldmark klar gemacht, dass es bei Wagner um jene „Innerlichkeit“ ging, die Hanslick, selbst von jüdischer Abstammung, dem jüdischen Komponisten ganz im Sinn von Wagners Aufsatz Das Judenthum in der Musik absprach. Hanslick war, so sehr er auch in der Charakterisierung der dramatisch problematischen, daher auch heute nur schwer auf die Bühne zu bringenden Oper recht hatte, ein Ignorant, als er die offenliegenden Sensibilitäten von Goldmarks Muse schlichtweg verneinte, auch behauptete, dass die Musik der Oper „monoton“ sei, was schon im Blick auf die ausgedehnten Ballette des 1. und 3. Akts, es zauberischen Vokalisengesangs der Dienerin Astarot wie des verzweifelten Duetts zwischen der Königin und ihrem Liebesopfer Assad so absurd ist wie vieles, was der Kritiker der Ewigkeit überantwortete.
Orientalismus in der Musik – der Vorwurf reichte aus, um das Werk bei den Großkopferten zu erledigen, bevor das Werk seinen beispiellosen Siegeszug an der Wiener Oper antrat, wozu allerdings auch die enormen Schauwerte eines makartnahen Historismus, das Spektakel der höfischen Märsche und Tänze im alten Land des König Salomo gehörten. Der Sammelband, Ergebnis eines Symposions von 2014, dreht sich weniger um Goldmarks andere Opern, von denen noch Das Heimchen am Herd einen gewissen Erfolg (auch beim konservativen Hanslick) erzielen konnte. Im Mittelpunkt steht die Königin von Saba, weil sie in Sache Ideologiekritik, Rezeption und Aufführungsgeschichte am interessantesten ist. Der schönste Quellenfund ist da zweifellos die Auffindung jener gestrichenen Passage, mit der die Titelfigur der Oper sich einführt und eine Motivation erhält, die in der heutigen, 1980 erstmals eingespielten Fassung nicht mehr ersichtlich ist. Goldmark stand, anders als Wagner, Strichen leger gegenüber; dies führte fatalerweise dazu, den Charakter der Königin zu verflachen. Ebenso spannend ist die Beobachtung, dass uns die letzte Neuinszenierung der Oper im austrofaschistischen Wien des Jahres 1936 wesentlich mehr über das spezifische Ansehen des jüdischen Komponisten verrät als die offizielle antijüdische Literatur einer korrumpierten deutschen Musikwissenschaft, für die der Komponist, der 1915 als ein in jedem Sinne alter Herr das Zeitliche segnete, nicht mehr war als ein Repräsentant einer vergangenen Epoche, die im Wien der 1930er Jahre und noch nach dem Zweiten Weltkrieg in nostalgischem Sinn als goldene Alt-Wiener Epoche verklärt wurde.
Goldmark selbst hatte es immer abgelehnt, sein Werk als „jüdische Nationaloper“ zu apostrophieren. Das war korrekt, doch haftete seinem Versuch, die Wurzeln seines Judentums in seiner spät geschriebenen Autobiographie fast vergessen zu machen, etwas Tragisches an: im Licht des am Ende des 19. Jahrhunderts grassierenden österreichischen Antijudaismus und Antisemitismus musste der Versuch einer jüdisch-österreichischen Symbiose so zum Scheitern verurteilt sein wie seine letzten Bühnenwerke, die schnell schon als altmodisch galten. Dass das Werk zwar dem musikalischen „Orientalismus“ angehört, aber, im Gegensatz zu den Einschätzungen auch eines Hanslick, ganz und gar nicht Einschlüsse jüdischer geistlicher Musik aufweist, blieb (von Daniel S. Katz) zu beweisen. „Der jüdisch-nationale Aspekt in der Königin von Saba“, so Golan Gur in seinem Beitrag Goldmark zwischen jüdischem Wagnerismus und deutschem Orientalismus, „ist in erster Linie in der Rezeption und nicht in der eigentlichen musikalischen Substanz zu finden“. Es versteht sich, dass – Stichwort: Orientalismus – in mehr als einem Beitrag Edward Saids Thesen zum Thema zitiert werden, wobei die politische Korrektheit leider meist überwiegt: als sei es per se verboten, kulturell „übergriffig“ eine Oper in einem fantastisch-üppigen Stil zu komponieren. Statt mit Victor Ségalen von einer „Ästhetik des Diversen“ zu reden, schlägt die Magistra Angelika Silberbauer in eine Kerbe, die von Naivität und Voreingenommenheit geprägt ist: als enthielte die Zeichnung des „Anderen“ automatisch ein feindseliges Element. Dabei wird umgekehrt ein Schuh daraus: gerade in der exotisierenden Zeichnung einer orientalischen Königin zeigt sich eine Faszination am bzw. der „Anderen“, die einzig bühnenwirksam ist (merke: politische Leitartikel und sich wissenschaftlich gerierende, in Freund-Feind-Denken feststeckenden Studien lassen sich nur zu höchst langweiligen Opern verarbeiten). Anders als die österreichische Kollegin sieht den Fall übrigens der Inder (!) Anil Bhatti: für ihn ist die Oper kein böses Stück über den ach so bösen Orient, sondern ein positives Beispiel jener Faszination am Anderen, das mit „Wissenszirkulation“ und „Wissensvermehrung“ zu tun hat.
Übrigens: In den sechs Jahren zwischen 1930 und 1936 wurde Die Königin von Saba an der Wiener Oper insgesamt zehnmal gespielt. Dies ist nicht viel, markiert wohl auch den verblassenden Glanz eines Stücks, zu dessen Vergessen es nicht die Nazizeit gebraucht hätte – eines Stücks, das im 19. Jahrhundert nicht zu Unrecht Furore machte, bevor es, das hat die Königin mit den Werken des einstmals geliebten Meyerbeer gemein, logischerweise von Werken mit stärkeren Dramaturgien und anderen Musikästhetiken überflügelt wurde. Dazu bedurfte es keines Nazi-Ideologen, sondern allein die Überzeugungskraft populärerer Stücke. Auch dies erfährt man, wenn auch eher indirekt, aus dem facettenreichen Sammelband, in dem sich Goldmarks Biographie, sein Hauptwerk in seinen textlichen und stofflichen Ur- und Hintergründen, die Rezeptions- und Pressegeschichte, die musikwissenschaftlichen Studien und die Untersuchungen zum Thema „Goldmark und das Judentum“ zu einer gut abgemischten und gar nicht zufälligen Melange verbinden. Man erfährt, und man liest es wieder mit Betroffenheit, wie sehr der damalige Großkritiker die Daten seiner Herkunft manipulierte. Möglicherweise bietet der Band mehr Fragen als haltbare Antworten; die Frage, welche Stelle Goldmark zwischen Meyerbeer, Wagner und sich selbst einnahm, ist ja nicht wirklich einfach zu beantworten, wofür die denkbar diversen Ansichten der Zeitgenossen und Nachlebenden bürgen, die sich um das Großwerk bemühten. Wo es um den „Stil und Inhalt“ – dies der Titel eines publizierten Aufsatzes von Goldmark – geht, ist Die Königin von Saba wie Goldmarks sonstiges Werk, das hier zugunsten der berühmten Oper ein wenig ins Abseits gerät, zweifellos brüchiger als der Tannhäuser. Dass es sich lohnt, sich mit dem heutzutage eher ungeliebten Werk zu befassen, weil es uns unendlich viel über die nicht allein opernmäßigen Verwerfungen des 19. Jahrhunderts verrät, wird dank des verdienstvollen Buchs schnell deutlich. Und vielleicht findet sich, in Nachfolge P.P. Pachls, der 2019, nicht ohne „Skandal“, seine Inszenierung in der Stiftskirche zu Klosterneuburg herausbrachte, ja demnächst wieder mal ein Experimentator, der es mit der Königin von Saba aufnimmt. Und sei es, um allein die musikalischen Schönheiten des Stücks vor dem Vergessen zu bewahren.
Frank Piontek, 20. Dezember 2022
Carl Goldmark. Leben, Werk, Rezeption.
Hrg. von Peter Stachel.
Hollitzer Verlag. Wien 2022.
355 Seiten. 50 Euro.
