Premiere: 22. März 2018, besuchte Vorstellung 23. März 2018
Kammerversion – ÖEA

Auch Leonard Bernstein zählt zu den Künstlern, für die heuer ein sehr rundes Jubiläum anfällt: Er wurde vor hundert Jahren geboren. Sein Österreich-Bezug war stark, und es ist nobel von der Neuen Oper Wien, dass man es sich mit der Aufführung zum Geburtstag nicht leicht macht. Denn Bernsteins Wunsch, eine „echte amerikanische Oper“ zu schreiben, war bekannt – ein ernstes stück, das sich musikalisch nicht an die Melodik der Populärmusik anlehnt, das inhaltlich seine Themen nicht romantisch verklärt.
Sein einziger relativ konsequenter Versuch dieser Art war „A Quiet Place“, an dem ziemlich herumgebastelt wurde, bis er am Ende die Kombination mit dem früheren Werk „Trouble in Tahiti“ aufgegeben hat. Wenn Reste davon vorhanden sind – so gut kennt man diesen frühen, 40minütigen Einakter nicht, um da Aussagen zu treffen. Eines steht jedenfalls fest: „A Quiet Place“ (1986 schon an der Wiener Staatsoper gespielt) war noch nie ein Erfolg, und das hat Gründe. Der Abend wird wohl auch diesmal nicht zum Publikumshit avancieren. Umso ehrenwerter, die Auseinandersetzung mit dem Werk dennoch auf sich genommen zu haben. (Wobei man noch erwähnen muss, dass es die Neue Oper Wien war, die 1999 „Trouble in Tahiti“ in Wien vorgestellt hatte.)

Ein Problem liegt schon an der Geschichte, die Librettist Stephen Wadsworth in Zusammenarbeit mit Bernstein, mit dessen vollem Einverständnis geschrieben hat. Alles an der Handlung schmerzt – schon der erste Akt bei der Trauerfeier für Dinah (wobei in der jetzigen Inszenierung nicht der Sarg auf der Bühne steht, sondern „nur“ eine Urne; schreckhaft genug, wenn diese umgestoßen wird, ein Sarg wäre natürlich noch effektvoller), wo die angeblichen Trauergäste sich eigentlich nur schlecht benehmen. Und der Besucher, der das Werk nicht kennt (also vermutlich die allermeisten) hat wirklich Mühe, aus den überbordenden Nebenfiguren diejenigen herauszuklauben, die später von Wichtigkeit sind – der Witwer Sam, sein Sohn „Junior“, die Tochter Dede und deren Mann Francois. Sie bestreiten die beiden nächsten Akte, die in der Aufführung der Neuen Oper Wien in ein- und demselben Bühnenbild von Christian Tabakoff spielen.
Aber auch wenn das peinliche „Begräbnis“ vorbei ist, wird es nicht erträglicher: Die Familie hat nämlich ihre enormen Probleme, und dass Junior und sein Schwager ganz offensichtlich ein homosexuelles Verhältnis hatten und noch immer schmerzlich daran herumzerren (was ziemlich deutlich ausgespielt wird), dürfte einem US-Publikum von anno dazumal (Uraufführung 1983 in Texas!) nicht wirklich behagt haben. Dazu kommt, dass eine Inzest-Geschichte zwischen den Geschwistern angedeutet wird und beide sich mit dem Vater nicht verstehen – kaum scheint angesichts der Erinnerung an die Mutter etwas sentimentale Besinnlichkeit eingezogen zu sein, gehen sie schon wieder darauf los. Am Ende gibt es zwar beschwichtigende Weisheiten, dass man sich verstehen sollte, aber Tatsache bleibt, dass man eine eineinhalbstündige Familienhölle mit ansehen muss, die nie aufhört, Unbehagen zu bereiten.
Das liegt auch an der Musik, in der Bernstein versucht hat, alles andere als gefällig, vielmehr europäisch modern zu sein, Klänge, in denen die Zweite Wiener Schule irrlichtert, in gnadenloser Behandlung der Singstimmen (wobei man auch als Englisch sprechender Zuseher die Übersetzung braucht, weil der Gesang einfach nicht zu verstehen ist, nicht zuletzt, weil sich die Stimmen immer wieder überlagern). Das, was man als „Bernstein“ im Ohr hat, kommt nicht eine Minute zum Tragen – und wüsste man nicht, dass er der Komponist ist, man käme nicht wirklich auf die Idee.
Der Abend macht es nicht nur dem Publikum, sondern allen schwer. Regisseur Philipp M. Krenn kann das Figuren-Chaos im ersten Akt nicht bändigen, ist dann in der psychologischen Führung des Familienquartetts weit besser.
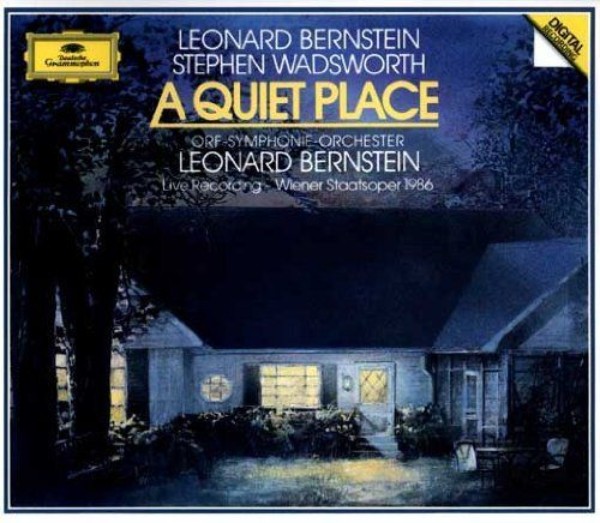
Die Sänger sind tapfer, die Estin Katrin Targo als Tochter Dede, die zwischen Vater, Bruder, Gatten hin- und hergerissen wird, in Erinnerung an die Mutter alles friedlich haben möchte und in alle Auseinandersetzungen hineingezogen wird – mit exzessivem Stimmaufwand, der sich peinigend in die Ohren bohrt. Steven Scheschareg als Vater mit schönem Bariton, Nathan Haller als Francois mit kräftigem Tenor und, am ergreifendsten, der ungarische Bariton Daniel Foki, wirklich jung, als der von seinem Nöten und Begierden gebeutelte Junior. Was es bedeuten soll, dass die Regie ihm am Ende eine Pistole an die Hand drückt, während der Vorhang langsam zugezogen wird – man möchte es gar nicht wissen, wie weit die Katastrophen gehen. Dass alles mal schöner war, verraten die (unvermeidlichen?) Videos, die Weihnachtsbescherung mit zwei Kleinkindern zeigen…
Es gibt eine Handvoll Trauergäste (unter denen Veronika Dünser scharfzüngig eine besonders unsympathische Aufgabe hat), dazu noch ein Vokalensensemble – und das bewährte amadeus emsemble-wien, das die Bernstein’sche Kammerversion, für diese Aufführung erstellt (Version und Librettoadaption von Garth Edwin Sunderland), unglaublich kleinteilig und differenziert realisieren muss. Man hört die Schwierigkeit des Ganzen mit jedem Ton, so souverän Walter Kobéra auch Orchester und Bühne zusammen hält.
Selbstverständlich wurde freundlich geklatscht. Ob Leonard Bernsteins Sorgenkind irgendwann in den Kanon der großen amerikanischen Opern aufgenommen wird, ist zu bezweifeln. Dieser Aufführung ist es wieder nicht gelungen.
Renate Wagner 23.3.2018
Bilder (c) Neue Oper Wien / DG
