Zum 125. Geburtstag
Um den angemessenen Titel für das Buch, das zum 125. Geburtstag der Wiener Symphoniker erschienen ist, hat man sicherlich hart gerungen, denn das Ergebnis ist ein das Geburtstagskind noch verleugnendes Wie funktioniert ein klassisches Orchester?, ehe sich ein sehr klein gedrucktes Ein Buch der Wiener Symphoniker anschließen darf. Damit trifft man jedoch den Inhalt der Festschrift, denn es finden sich in ihr, von ganz unterschiedlichen Autoren verfasst, Kapitel über klassische Musik im Allgemeinen und die sie Ausübenden wie spezielle, sich den Symphonikern widmende. Ebenso breit gefächert ist das Autorenteam, in dem sich Musikwissenschaftler, deren einer auch der Herausgeber Otto Biba ist, Dirigenten, Orchestermitglieder, Kritiker, Historiker und auch eine Sängerin finden. In ihren kurzen Biographien nimmt man schmunzelnd zur Kenntnis, eine wie viel größere Bedeutung als in Deutschland im Nachbarland Österreich Titel und Auszeichnungen noch zu haben scheinen und dass, so schmerzlich es gerade im Moment freudigen Feierns sein mag, der Wechsel von den Symphonikern zu den Philharmonikern als Aufstieg auf der Karriereleiter gesehen wird.
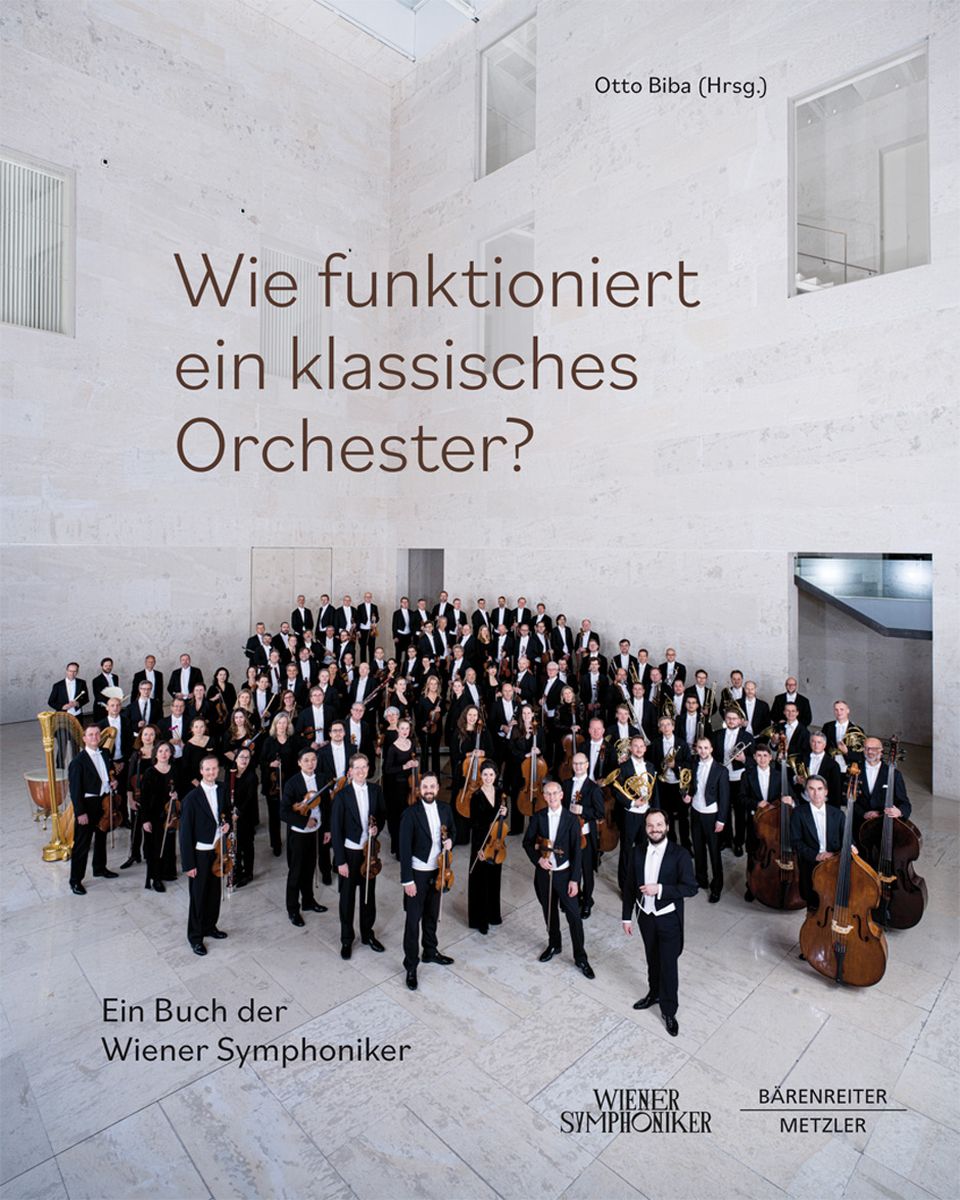
Um noch beim Anhang zu bleiben: Er umfasst außer den Kurzbiographien der Autoren die üblichen Anmerkungen, Personenregister und Bildnachweis. Besonders wertvoll ist ein kenntnisreiches Glossar von Reinhard Ölberger.
Im Vorwort bekennt sich der Herausgeber ausdrücklich dazu, dass man keine Festschrift, sondern ein für Orchester generell zutreffendes, allgemeingültiges Bild habe zeichnen wollen, für das sich die Wiener Symphoniker als Beispiel besonders gut zu eignen scheinen. Dazu gehört auch ein akribisch aufgezeichneter Werdegang durch die unterschiedlichsten Bezeichnungen, Rechtsformen und Geldgeber, bis 1945 der endgültige Name sowie Stadt und Land Wien als wesentliche Geldgeber feststanden. Der lange Zeit nur als Sinfonieorchester wirkende Klangkörper ist seit 1946 auch das Opernorchester für Bregenz, und ab 2006 wirkt es auch regelmäßig an Produktionen des Theater an der Wien, neuerdings Musiktheater an der Wien mit.
Ungefähr je zur Hälfte geht das Buch chronologisch vor, danach systematisch, indem über Probleme innerhalb der Hierarchie (allerdings nicht mehr Streicher gegen Bläser), über unterschiedliche Arbeitsweisen der Dirigenten (berühmte und berühmteste von Furtwängler über Karajan bis zu Giulini oder Abbado wirkten hier) oder über den Kampf um die ersten Frauen im Orchester berichtet wird. Der dritte Teil widmet sich der Charakterisierung des Orchesters und der Ausrichtung auf seine Zukunft.
Jedes Kapitel hat neben dem Titel noch einen erläuternden Untertitel, der dem Leser die Entscheidung darüber leichter macht, ob er sich für den Inhalt interessieren sollte oder nicht. Ganz bestimmt wird er sich für den historischen Überblick, der zudem deutlich macht, welche Vielfalt in Bezug auf die Vermittlung klassischer Musik in Wien mit seinem Nebeneinander von Hofkapelle, Dilettantenorchestern, Tanzkapellen, ja sogar Militärkapellen herrschte, wie gering der Qualitätsunterschied zwischen Berufs- und Dilettantenorchester sein konnte. Durchaus nicht uninteressant sind die zahlreichen, schließlich scheiternden Versuche von Orchestergründungen. Diese werten natürlich die Symphoniker, wenn auch mit immer wieder sich änderndem Namen, umso mehr auf, wenn sie allen Widrigkeiten, sogar denen zweier Weltkriege, trotzten.
Wilhelm Sinkovicz nennt sein Kapitel zwar Kleine Geschichte, entwirft aber ein umfassendes Bild vom Konzertleben in Wien, das nicht nur Oberschicht und Mittelstand zugänglich war, sondern auch Konzerte für Arbeiter und Mittelschüler umfasste, sich mit Beisl- oder Prater-Picknick-Konzerten an alle Wiener wandte. In einem weiteren Kapitel befasst sich der Autor mit dem Wirken der Symphoniker in der Oper, dem Verhältnis Sinfonie-Oper, den unterschiedlichen Anforderungen an ein Orchester.
Oliver Rathkolb schreibt über ereignisreiche Jahre wie das des Staatsstreichs 1933 und des Anschlusses und seiner Folgen, aber auch über ein belustigendes Ereignis wie das Watschenkonzert von 1913. Wie in vielen anderen Kapiteln des Buchs geschehen, geht er über die Symphoniker hinaus und widmet auch den Philharmonikern einiges an Zeit und Raum, ehe die Symphoniker am Schluss des Kapitels am 1. April 1945 wieder mit Proben beginnen und am 9. des Monats ihr erstes Konzert nach dem Krieg mit Mahler im Programm geben.
Mit den Vorurteilen, teils lächerlichen, teils diskriminierenden gegen Frauen im Orchester befasst sich Ingrid Fuchs, weiß viele Beispiele für segensreiches Wirken derselben auch in der Musik aufzuzählen und stellt fest, dass inzwischen immerhin ein Drittel des Orchesters aus Frauen besteht.
Walter Weidringer hat die Dirigenten des Klangkörpers ins Visier genommen, ihre unterschiedliche Art zu proben, der Zeichengebung und der gegenseitigen Wertschätzung. Vieles bleibt allgemein, d.h. nicht verbunden mit den Symphonikern, aber deswegen nicht uninteressant, mit Sawallisch, Giulini, Prȇtre, Pochner, allerdings auch viel über das Bruckner Orchester Linz. Zumindest Erwähnung finden Jordan, Luisi, und der jetzige Dirigent Petr Popelka wird als „Glücksgriff“ gefeiert.
Recht allgemein gehalten sind die Ausführungen von Joachim Reiber, nichtsdestoweniger interessant, wenn er sich „spielerisch betrachtet“, man könnte auch sagen geistreich und amüsant, über das „Spielen“ äußert. Er kommt aus der Praxis, wenn auch der des Wiener Singereins.
Über Schlagtechnik, Urtext, die Gegensätze von Toscaninis „Come è scritto“ und Furtwänglers Kritik daran schreibt Peter Gülke, stellt die Frage nach der Relevanz des Urtexts und gibt Orchester wie Dirigenten Ratschläge, wie es zu einer konfliktloseren Zusammenarbeit kommen könnte. Stoff zum Nachdenken bietet das „Unnennbare“, das beide miteinander verbindet.
37 Jahre lang spielte Ernst Kobau bei den Symphonikern und qualifizierte sich damit für einen profunden Blick auf den Dirigenten als solchen. Orchestermusiker sind für ihn Leistungssportler, durchaus in der Lage, ohne Dirigenten zu spielen, zu dem man entweder ein subkutan-gruppendynamisches, ein pragmatisches oder ein wertorientiertes Verhältnis haben kann. Eine Auffächerung des Konfliktpotentials zwischen Dirigent und Orchester soll behilflich sein, dasselbe zu minimieren. Dieses Kapitel liest man mit besonderem Gewinn, Anschaulichkeit, Wissen und Überzeugung machen es interessant, so die Ausführungen über Regietheater und Dirigenten, den Wandel des sozialen Status der Musiker, die witzige Charakterisierung einzelner Persönlichkeiten. Auch die herkunftsbedingten Unterschiede zwischen deutschen, italienischen und französischen Dirigenten werden immer mit einem Schuss Ironie betrachtet, ja, es ist auch von einem „illusions–ironischen Blick“ heutiger Orchestermitglieder auf Dirigenten die Rede. Schade, dass dieser Autor nicht ein ganzes dickes Buch über seine Erfahrungen geschrieben hat. Immerhin gewährt er in einem weiteren Kapitel „sozialpsychologische Einblicke eines Mitspielers“ in das Verhältnis zwischen Arbeitsatmosphäre und eigener Identität, schreibt über Frauen im Orchester und die Bedeutung von Tourneen.
Über Orchester und Publikum referiert, als einzige gendernd, Monika Mertl, betrachtet vergleichend Wien und Leipzig miteinander und findet ihr Ideal von einem Publikum in Japan und Korea. Walter Weidringer schreibt über die Bedeutung von Festspielen, Tourneen, Aufnahmen und weiß sich auch zu den Vorteilen gegenüber und Problemen mit Philharmonikern zu äußern. Ulrike Sych leistet einen Beitrag zum Buch mit Ausführungen über die Ausbildung zum Orchestermusiker, Jan Nast, derzeitiger Intendant der Symphoniker, wirft ein erhellendes Licht auf das Jubiläumsjahr und stellt fest, dass der Klang des Orchesters sich im Verlauf der Zeit verändert, aber stets seine Unverwechselbarkeit erhalten hat. Er schildert die Besonderheiten der einzelnen Epochen und vergleicht, aus Dresden kommend, mit den dortigen Orchestern, weist auf die drei Spielstätten Konzerthaus, Musikverein, Musiktheater (neuerdings!) an der Wien und die Aktionen hin, die das Orchester den Wienern noch näher bringen soll: Prater-Picknick, Adventskonzert im Stephansdom, Ferienbeginn-Konzert sowie auf die Verbindungen nach Peking und nach Triest.
Haben sich die Wiener Symphoniker selbst ein schönes Geburtstagsgeschenk und den Musikfreunden eine Freude gemacht? Im Großen und Ganzen kann man das bejahen, aber für die mit persönlichen Erfahrungen verbundenen und mit aus ihnen erwachsenden Einsichten glänzenden Kapitel ganz besonders.
Ingrid Wanja, 21. Oktober 2025
Otto Biba (Herausgeber): Wie funktioniert ein klassisches Orchester?
Ein Buch der Wiener Symphoniker
Bärenreiter/Metzler Verlag, 2025
ISBN 978 3 7618 2665 2 (Bärenreiter)
