Ein neues Standardwerk
In der Oper wird heute viel zu selten gelacht. Im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert sah das ganz anders aus: Die italienische Opera buffa war die am weitesten verbreitete Form des Musiktheaters in Europa, und Komponisten wie Domenico Cimarosa, Giovanni Paisiello und bald allen voran Gioachino Rossini beherrschten die Spielpläne.
Eben darüber hat der renommierte und außerordentlich produktive Musikwissenschaftler Arnold Jacobshagen jetzt eine Publikation vorgelegt, die Respekt abnötigt. In ihr schreibt er: „Die Opera buffa war im 18. und 19. Jahrhundert eine der am weitesten verbreiteten Theaterformen weltweit. Der außerordentliche Erfolg der komischen italienischen Oper beruhte nicht zuletzt darauf, dass sie in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhangen aufgeführt werden konnte und sowohl an populären Bühnen wie auch an fürstlichen Residenzen heimisch war.“
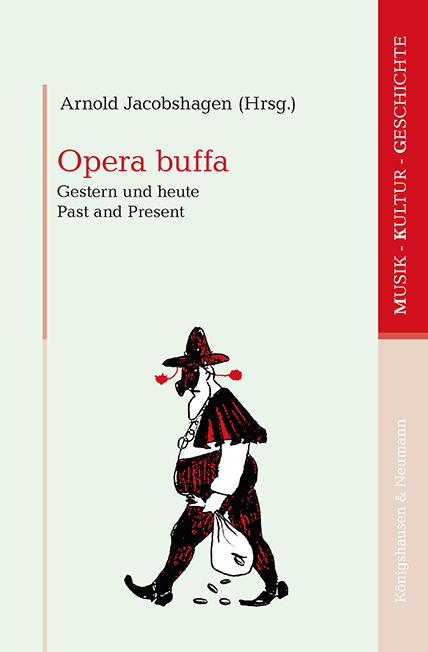
Zu den Säulen des internationalen Opernrepertoires zählen bis heute Wolfgang Amadeus Mozarts Le nozze di Figaro (1786), Don Giovanni (1787) und Cosi fan tutte (1790), Gioachino Rossinis Il Barbiere di Siviglia (1816), La Cenerentola (1817) und Il Viaggio a Reims (1825) sowie Gaetano Donizettis L’elisir d’amore (1832) und Don Pasquale (1843). Sie stehen noch immer regelmäßig auf den Spielplänen der großen und kleinen Bühnen weltweit.
„Ab der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts haben sich jedoch nur noch wenige komische italienische Opern bis in die Gegenwart behauptet: Giuseppe Verdis Falstaff (1893) und Giacomo Puccinis Gianni Schicchi 1918 werden oftmals als letzte Repräsentanten einer Gattung benannt, deren große Zeit der Vergangenheit anzugehören scheint. Diese Stücke sind jedoch nur teilweise repräsentativ für eine Theaterform, deren immense Vielfalt und jahrhundertelange Traditionen für ein heutiges Publikum neu erschlossen werden können.“
Die Beiträge des von Jacobshagen vorgelegten Bandes dokumentieren die Beiträge der internationalen wissenschaftliche Konferenz „Opera buffa gestern und heute“, die vom 19. bis 21. April 2024 an der Hochschule für Musik und Tanz Köln als Teil des von der Stiftung Zukunft NRW geförderten wissenschaftlich-künstlerischen Forschungsprojekts ,,Die Opera buffa und ihre internationale Rezeption“ stattfand.
Ziel dieses von Stephan Wehr, Arnold Jacobshagen und Heike Sauer geleiteten Projektes war es, die Opera buffa und ihre internationale Rezeption bis in die Gegenwart zu untersuchen und durch exemplarische Aufführungen einzelner Werke zu vergegenwärtigen. Die drei ausgewählten und in den Jahren 2023 bis 2025 in der Hochschule für Musik und Tanz Köln szenisch aufgeführten Opern präsentieren unterschiedliche Epochen dieses Wandlungs- und Rezeptionsprozesses: Neben einem in Vergessenheit geratenen und im Rahmen dieses Projekts eigens wissenschaftlich edierten Originalwerk des späten 18. Jahrhunderts (Le trame deluse von Domenico Cimarosa) Wurden eine Oper des frühen 2O. Jahrhunderts (Ariadne auf Naxos von Richard Strauss) sowie eine moderne Bearbeitung aus dem späten 20. Jahrhundert (Il Re Teodoro a Venezia von Giovanni Paisiello in der Fassung von Hans Werner Henze) zur Aufführung gebracht. So wurde den beteiligten jungen Künstlerinnen und Künstlern die Gelegenheit geboten, unterschiedliche Stilistiken und Darstellungsweisen zu erproben. Diese dreijährige künstlerisch-praktische Arbeit wurde von umfassenden musikwissenschaftlichen Untersuchungen getragen, welche neben der quellenkritischen Edition von Le trame deluse in die Veröffentlichung des vorliegenden Buches münden. Die Neuproduktion von Cimarosas Le trame deluse bildete somit das Zentrum des Projekts und wird in diesem Band neben einzelnen Textbeitragen auch durch Szenenfotos der Kölner Aufführungen im April 2024 dokumentiert.
„Die Beiträge des vorliegenden Buches vereint das Bestreben, die diversen Entwicklungen der Opera buffa in Geschichte und Gegenwart aus multiplen Perspektiven zu betrachten und dabei neue Sichtweisen zu eröffnen. Aus diesem Grund wurden die viel gespielten Opern von Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi und Puccini bewusst ausgeklammert, um das Augen- und Ohrenmerk auf weniger bekannte Aspekte und weithin vergessene Werke des komischen Genres zu richten.“ (Jacobshagen)
Neben der Dokumentation der erwähnten Werke und einer szenischen Aufführung versammelt der Band zwanzig Aufsätze und Essays, die den wissenschaftlichen Kommentar und die Ergebnisse der Konferenz präsentieren, unter anderem wie sehr die frühe Opera buffa mit der Commedia dell’arte in Verbindung stand und auf deren Figurenmuster und Szenentypen aufbaute, wie die europäische Ausbreitung der Gattung Opera buffa um die Mitte des 18. Jahrhunderts funktionierte. Es gibt Detailuntersuchungen zu einzelnen musikalischen Bühnenwerken und Entwicklungen vom 17. bis ins 21. Jahrhundert. Auch richtet sich der Blick in Metropolen wie London, in denen Sängerinnen und Sänger des King’s Theatre in den 1760er Jahren in der neapolitanischen Oper brillierten. Mehrere Beiträge sind dem Komponisten Domenico Cimarosa gewidmet, dessen Oper Le trame deluse (1786) im Rahmen des genannten Forschungsprojekts unter der künstlerischen Leitung von Timo Handschuh, Thilo Reinhardt und Stephan Wehr dreimal zur Aufführung kam.
Im besonders aufschlussreichen Beitrag von Arnold Jacobshagen wird dieses Werk im Kontext der komischen Opern Cimarosas und ihrer Aufführungen irm18. Jahrhundert untersucht, ehe sich Tina Hartmann speziell mit den Weimarer Aufführungen von Le trame deluse unter der Leitung von Johann Wolfgang von Goethe auseinandersetzt und dabei auch eine neue Sichtweise auf Goethes Vorstellungen von der Opera buffa entwickelt.
Einige Texte des Buches haben die italienische komische Oper im 19., 20. und 21. Jahrhundert zum Gegenstand, wobei Enzyklopädien, Musiklexika, Musikzeitschriften und biographische Werke systematisch ausgewertet werden. Dabei zeigt sich, dass die Cimarosa-Rezeption zwischen dem Ende des Ancien Regime und dem Sturz Napoleons ihren Höhepunkt fand und sich später vor allem auf die Wiederaufführungen von Il Matrimonio segreto beschränkte.
Ein umfassender Katalog komischer italienischer Opern im 20. Jahrhundert einschließlich einer detaillierten Dokumentation ihrer Rezeptions- und Aufführungsgeschichte ist angefügt, um die langanhaltende Nachwirkung des Genres deutlich werden zu lassen. Auch Ermanno Wolf-Ferrari und Alberto Franchetti (vor allem dessen erst spät von Helmut Krausser wiederentdeckte Oper Don Buonaparte) kommen dabei ausführlich zur Sprache, bevor der Bogen geschlagen wird bis zur Rezeption des Genres seit 1960 bis in die Gegenwart.
Wertvolle bibliographische Anmerkungen ein nützliches Register komplettiert das wichtige, mehr als vierhundertseitige Buch, das eine Lücke der Forschung schließt, eine Summe zieht und schon jetzt als Standardwerk zum Thema „Opera buffa gestern und heute“ betrachtet werden darf.
Dieter David Scholz, 19. Oktober 2025
Arnold Jacobshagen (Hrsg.): Opera buffa. Gestern und heute
Verlag Königshausen & Neumann, 2025
424 Seiten
ISBN: 978-3-8260-9547-4
