Venezianischer Carneval auf Hamburgisch
„Der angenehme Betrug oder Der Carneval von Venedig“ erfreute sich seinerzeit an führenden Opernhäusern in mittel- bis norddeutschen Landen besonderen Beliebtheit. Das «Spiel mit Gesang», welches den Gästen der Hamburger Oper am Gänsemarkt als auch des Leipziger Opernhauses am Brühl ein Menü großer Affekte servierte, zeichnete aus Sicht des deutschen Barocks, wie der ihn hier vertretenden Komponisten Reinhard Keiser, Christoph Graupner und Johann David Heinichen, ein italienisches Fantasiebild, das sich mit «La dolce vita», «Aventure amorose», italienischem Machismo und allerlei ähnlichen «Lastern» beschäftigte.
Die Arien und Duette thematisieren die ewige Liebe, ewige Treue, leichtfertigen Betrug, quälende Eifersucht, Trauer und große Freiheit. Allen voran steht allerdings das Motto der «teutschen Prinzessin Celinde» – „Frei von Lieben, frei von Leiden“ – demgemäß sie sich nach der Stadt in der Lagune begeben hat, um die Opern der dortigen Karnevalssaison zu besuchen.
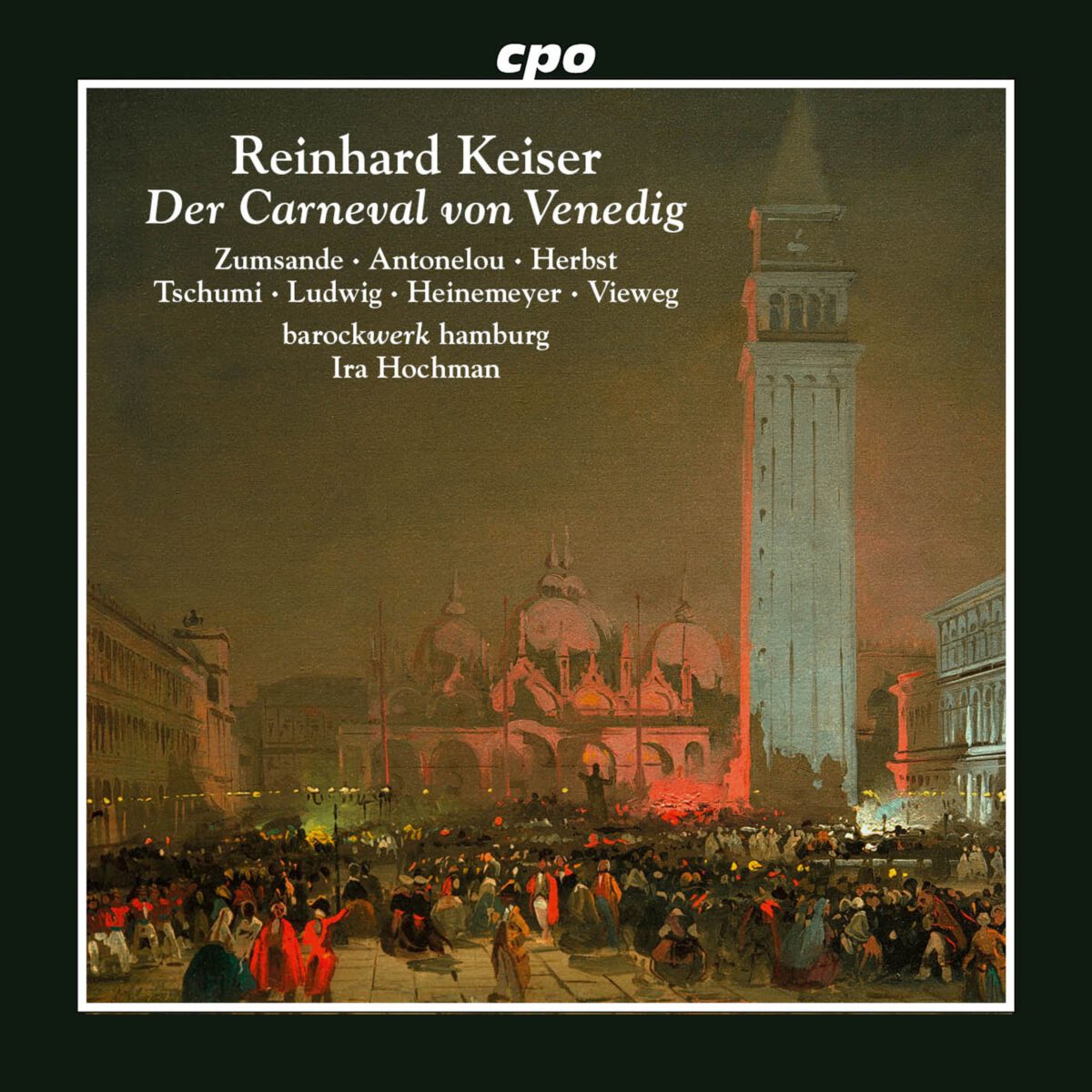
Zur Handlung: Es geht in der Oper um zwei venezianische Liebespaare, Leonore und Leander sowie Isabella und Rudolfo während des Karnevals in Venedig. Leander verliebt sich in Isabella, während Rudolfo Leonore liebt. Rudolfo behauptet Leonore gegenüber, Leander sei tot, um sie zu gewinnen. Doch Leonore bemerkt, dass Leander noch lebt und behauptet nun ihm gegenüber, Isabella sei tot. Damit sind Leonore und Leander wieder vereint. Auch Isabella und Rudolfo werden schließlich wieder ein Paar. (Man denkt an Mozarts „Cosi fan tutte“, deren Handlung ganz ähnlich ist.)
Ein weiteres „Paar“ sind Celinde, eine „verkleidete Prinzessin aus Teutschland“, welche sich nur für Tanz und Oper interessiert und von der Liebe nichts hören mag, denn Liebe bedeutet für sie Leiden, und ihr Verehrer Myrtenio, ein „Teutscher Prinz“, der sehr unglücklich ist, dass Celinde ihn nicht erhört, sich aber schließlich von ihr überzeugen lässt, der Liebe zu entsagen, um nie aus Liebe leiden zu müssen. Mit der Soubrettenfigur der Celinde „verbeugt sich die hamburgische Oper vor der venezianischen Tradition, indem sie mit ihr…eine Protagonistin vorstellt, die sich wesentlich mehr für die Karnevalsoper als für die Avancen ihres Verehrers Myrtenio interessiert“, (so im Booklet vorliegender Einspielung). Beim Happyend der Oper schließlich besingt der Chor denn auch die Moral des Karnevals wie der Oper: „So kann uns diese schöne Zeit auch die schönste Freiheit geben“
Die Textvorlage der Oper war Anfang des 18. Jahrhunderts so beliebt, dass das Werk immer wieder umgeschrieben und weiterentwickelt wurde. Das ursprüngliche Hamburger Libretto beruhte auf einem französischen Vorbild, dem Comédie-Ballett „Le Carneval de Venice“ von André Campra, uraufgeführt in Paris 1699. Der herzoglich sachsen-weißenfelsische Sekretär und Prokurator Johann August Meister übersetzte das Textbuch zunächst für den Weißenfelser Hof, dann für die Hamburger Gänsemarkt-Oper. Dabei veränderte er die französiche Oper nach örtlichem Geschmack.
Keisers Oper ist zwar vorwiegend in hochdeutscher Sprache geschrieben, enthält aber auch einige Arien in italienischer, französischer und plattdeutscher Sprache. Die „nieder-sächsischen Mägde“ Trintje und Severin reden bzw. singen plattdeutsch. In der Oper wird als Huldigung an Italien ein Lied auf die Melodie von „O mamma, mamma cara“ gesungen, das auf eine neapolitanische Canzonetta zurückgeht. Später wurde es u. a. als das Lied „Mein Hut der hat drei Ecken“ bekannt. Die dreisprachige, deutsch-italienisch-französische Textversion war übrigens typisch für das Haus an der Alster. Die Hamburger waren eben immer schon weltoffen.
Als Komponist des Werks wird übrigens neben Reinhard Keiser auch der Darmstädter Komponist Christoph Graupner genannt. Wer die Weißenfelser Fassung komponiert hat, weiß man nicht. 1709 gab es auch in der Leipziger Oper am Brühl eine Fassung, die wohl Johann David Heinichen komponierte, der am Sächsischen Hof zu Dresden reüssierte. Nicht zu vergessen: Die Hamburger Gänsemarktoper und das Leipziger Opernhaus am Brühl waren die ersten bürgerlichen Opernhäuser in Deutschland, um so verständlicher, dass die Begeisterung über reale Menschen und nicht etwa antike Figuren, Gottheiten oder mythische Figuren im „Karneval von Venedig“ in Hamburg wie in Leipzig groß war.
Mit Keisers „Carneval von Venedig“ wurde nicht zuletzt die Tradition der „Lokal-Singspiele“ begründet. Diese plattdeutschen Teile der Oper waren geradezu Garanten ihres Erfolgs. Das Publikum war begeistert. Keisers „Carneval in Venedig“ war eine der ersten Opern mit plattdeutscher Einlage. Die zotig-komödiantischen Rollen der Bediensteten, die sich auch sozial- und obrigkeitskritisch äußerten, begeisterten verständlicherweise die einfachen Bürger auf den billigen Theaterplätzen.
Keiser war nachweislich von 1703 bis 1706 Direktor der Gänsemarktoper in Hamburg. Durch die nicht vollständig überlieferten Lebensstationen Keisers ist aber die Geschichte der Oper „Der angenehme Betrug oder Der Carneval vonVenedig“ nicht restlos geklärt. Keiser, der aus Teuchern bei Weißenfels stammte, hielt sich nachweislich zur Premiere seiner Oper Almira 1704 in Weißenfels auf. Daneben sind auch Aufenthalte Keisers zwischen 1706 und 1709 in Weißenfels dokumentiert. Im Jahre 1705 wurden lt. Gottsched an der Weißenfelser Hofoper dessen Oper „Der Karneval in Venedig“ aufgeführt. Ob Keiser oder Johann David Heinichen hier der Komponist war, ist nicht wirklich klar. Im Jahre 1707 erfolgte dann die Uraufführung in Hamburg. Die Oper wurde dafür von Christoph Graupner bearbeitet (der wahrscheinlich einige Arien dazukomponierte), von Mauritz Cuno († 1712) mit plattdeutschen Texte angereichert und erhielt der Zusatz Der angenehme Betrug. Die Oper avancierte zu einer der beliebtesten an der Gänsemarktoper, so dass dort weitere Aufführungen in den Jahren 1708, 1711, 1718, 1723–1725, 1731 und 1733–1735 bezeugt sind. Auch an der Leipziger Oper am Brühl 1709 und am Opernhaus vorm Salztor in Naumburg 1711 sind Aufführungen der Oper dokumentiert.
Die Oper wurde nun am 3. Juli 2022 im Altonaer Theater vom Ensemble Barockwerk Hamburg neu aufgeführt. Eine zweite Aufführung erfolgte im Rahmen der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik am 13. August 2023. Die Grundlage der vorliegenden Einspielung ist eine (verschollen geglaubte) Hamburger Musikhandschrift, die erst 1991 aus kriegsbedingter Verlagerung gen Ostdeutschland nach Hamburg zurückkehrte. Der hohen Zahl an überlieferten 32 Arien, vier Duetten und einem Chor stehen allerdings wesentliche Teile der Oper gegenüber, die nicht erhalten sind. Dazu gehören die Ouvertüre, Tanzmusiken, welche durch Musiknummern aus anderen Opern Keisers ergänzt werden mussten, und sämtliche Rezitative, welche rekonstruiert wurden. Der traditionelle Gebrauch der Perkussionsinstrumente – typisch für den Karneval – wurde „frei improvisierend getrommelt, gerasselt und geklappert.“ Einige Chöre wurden aus anderen Keiser-Opern entwendet, Chöre in denen es ums pure Vergnügen geht: Trinken, Tanzen, Glücksspeilen und Singen. Die verschollene Ouvertüre wurde einer von dem Keiser-Zeitgenossen Johann Mattheson in seinem Werk „Der vollkommene Capellmeister“ als bespielhaft erwähnten, aber nicht einem bekannten Werk Kaisers zuzuordnenden schmissigen Ouvertüre ersetzt. Auch gibt es gibt Anleihen von Regnard und Campra, aber auch Entlehnungen aus der Oper „Heinrich der Vogler“ von Georg Caspar Schürman (einem weiteren Komponisten der Gänsemarkt-Oper). Es handelt sich um sein im niederdeutschen verfassten „Mummelied“, in dem vom guten Rheinischen Wein und von „Swiens-Braden“ die Rede ist.
Das von Ira Hochmann 2007 gegründete Ensemble Barockwerk Hamburg (das sich auf Erst- und Wiederaufführungen vergessener Kirchenmusik- und Bühnenwerke des Barocks spezialisiert hat), haucht dieser Oper neues Leben ein. Mit einem kleinen, aber feinen Instrumentalensemble (24 Instrumentalisten), das Sinn hat für die zum Teil exotische Instrumentierung und die Tanzrhythmen der Musik und einem handverlesenen Ensemble von sieben koloraturenfreudigen und stilsicheren Sängern präsentiert man eine sehr respektable, historisch-informierte, lebendige Aufführung des weithin vergessenen Werks, das immerhin mit 52 Musiknummern und insgesamt rund 120 Minuten reiner Musikzeit aufwartet.
Die Korrepetitorin, Dozentin, Dirigentin und Cembalistin Ira Hochmann, welche die Aufführung mit sensiblem Temperament leitet, bekennt im Booklet „Wir haben bei unserer Rekonstruktion der Oper den Begriff der Freiheit als Kernaussage gesehen: eine Kernaussage sowohl des Karnevals per se als auch der Oper ‚Der angenehme Betrug oder Carneval von Venedig‘.“
Sie versteht es mit Präzision, Feingefühl und Verve, der kurzweiligen, extrovertierten und abwechslungsreichen Musik, die bewusst mit musikalischen Stilmitteln spielt, trotz ihrer Schwächen und Längen Leben, mit Einschränkungen sogar einen gewissen interpretatorischen, will sagen spieltechnischen Grad von Italianità zu verleihen, obwohl in der Oper nichts wirklich „Italienisch“ klingt. Unterhaltsam ist sie trotzdem und klingt nach bestem Keiser, immerhin.
Dieter David Scholz, 15. November 2025
Der angenehme Betrug oder der Carneval von Venedig
Oper von der Akten von Reinhard Keiser
barockwerk Hamburg
Ira Hochmann
2 CDs CPO 555 581-2
2025
