Vor einigen Tagen herrschte andachtsvolle, keine ohrenbetäubende Stille zwischen den Klavierstücken, die von der jungen Pianistin Iarina Mărgărit in Steingraebers Kammermusiksaal zu Gehör gebracht wurden. Viel Liszt und ein bisschen Wagner, das war das Programm. Drei Tage vor Ende der Bayreuther Festspiele 2025, an sie man sich schon aufgrund der Neuinszenierung der Meistersinger von Nürnberg und eines teilweise sensationell gut besetzten Ring des Nibelungen erinnern wird, macht der Hausherr in Wahnfried eine Ansage: Die Künstler verbäten sich den Applaus zwischen den Musikstücken: „aus atmosphärischen Gründen“. Der Applaus kommt denn aber doch: am Schluss, denn mit dem Ausklang des Wahnfried-Konzert-Programms 2025 hat das Bayreuther Wagnermuseum seine Festspiele auf gediegene Weise abgeschlossen.
„Musik bei den Buddenbrooks – Zum 150. Geburtsjahr Thomas Manns“, so lautet der Titel, der dem „Wagnerianer“ (wie Sven Friedrich sagt) Reverenz erweist – denn Mann, der im Lauf seines Lebens durchaus sich wandelnde Positionen zu Wagner einnahm, hat sich mit dem Komponisten nicht allein auf essayistischer und privater Ebene befasst. Sein erster wirklich großer Wurf, Die Buddenbrooks, so etwas wie Der fliegende Holländer, soweit es den durch nichts gehinderten Zug betrifft, der durch dieses vergleichslose Frühwerk geht – der Roman vom Verfall einer Familie hat es so weit mit Wagner zu tun, dass er zugleich Handlungsobjekt wie auch dramaturgischer Wegweiser ist. In Kürze: die Schauspielerin Sibylle Bertsch las die betreffenden Musik-Kapitel, und Cosmin Boern spielte mehr oder weniger dazu passende Klavierstücke – doch die Musik „passt“ ja immer, thematisch direkt oder assoziativ ergänzend, begleitend, verstärkend. Wenn zu Beginn Bachs Präludium und Fuge BWV 847 erklingt – das ist das berühmte Präludium aus dem WTK I mit den sprudelnd vorangetriebenen Sechzehnteln und der Fuge mit den für die Oper so charakteristischen Viererketten -, fühlt der Wagnerkenner sich wie von selbst sofort an die Meistersinger erinnert. Wagner nannte das „angewandten Bach“ – und Die Meistersinger spielen dort eine Rolle, wo Gerda Buddenbrooks Spielpartner und Hanno Buddenbrooks Klavierlehrer Edmund Pfühl sich langsam in Richtung Meistersinger bewegt, nachdem er den Tristan als Machwerk der décadence in Grund und Boden verdammt hat.
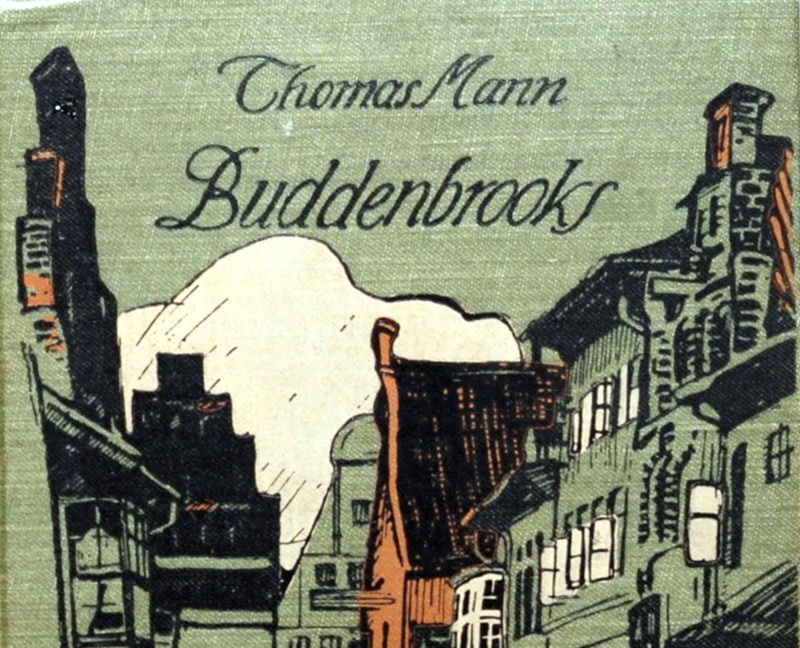
Es passt schon deshalb, weil Wagner in diesem Raum immer wieder die Präludien und Fugen gespielt hat, während er den Parsifal schrieb. Die „Dekadenz“, die zumal von französischer Seite – in durchaus positiver Hinsicht – den reifen Werken attestiert wurde, spiegelt sich an diesem Abend zuerst im Tristan-Vorspiel, das vom Pianisten nicht weichlich, sondern hart und klar gebracht wird. Hannos Klavierunterricht wird von Nietzsches Heldenklage begleitet, weil mit dem Jungen der Erbe stirbt, der die Dynastie retten sollte: ein Opfer auch der Verfallenheit an die Töne des Zaubermeisters von Bayreuth. Dagegen half nicht einmal die Aufgeräumtheit Bachs. Denn so, wie sich Liszt Bach zu eigen machte, als er dessen Fantasie und Fuge g-Moll BWV 542 für Klavier einrichtete, konnte Wagner auf keine sensible Seele wirken. Wenn der Vater und Senator Thomas Buddenbrook den Sohn wegen dessen Schwäche schilt, hören wir im Anschluss Liszts Bearbeitung des Abendsterns – gewiss keine Musik der tristanesken „décadence“. Wer mehr über die weit über die privatmusikalischen Gefühle hinausreichenden Zusammenhänge zwischen Deutschtum und politischer Hegemonie, décadence und antifranzösische Affekte wissen will und wie sie in die deutsche Geschichte und noch auf Thomas Manns Spätwerk wirkten, lese Hans Rudolf Vagets Seelenzauber, ein glänzendes Buch über Thomas Mann und die Musik.
Allein es ist ja schon in höherem Sinne witzig, in Wahnfrieds Salon auf die Erzählung von Gerdas und des Leutnants von Trotha Affaire Brahms op. 116/7, also das Capriccio aus den 7 Fantasien zu hören. Denn 1. wäre Wagner entsetzt gewesen, und 2.. passt es, als wär’s eine Hörspielmusik. Wenn schließlich Liszts 3. Liebestraum – der Liebestraum – ertönt, haben wir es mit geradezu Mannscher Ironie zu tun, denn wo sich endlich Hanno und sein Vater über die Entfernung von der Mutter einig sind, ertönt eine rauschhafte Musik, die nur noch das Unmöglich zu beschwören vermag.
Der schwarzäugige von Throta trägt, natürlich nicht zufällig, die Vornamen „Réne Maria“; als Zugabe kommt Rilkes Der Schwan zu Gehör, danach Schumanns Träumerei. „Zum letzten Mal Psychologie“, heißt es in einem Tagebucheintrag Franz Kafkas. Zum letzten Mal Thomas Mannsche Ironie, denkt der Hörer – denn so wenig wie Brahms in Wahnfried etwas galt, so sehr verachtete Wagner Schumann. Der habe, so Wagner einmal zu Cosima Wagner, keine einzige Melodie geschrieben, im Übrigen sei er, sagte er 1879 in Wahnfried, ein „Dorfmusikant“ gewesen, „ohne Seele, ohne Einfälle“.
In Wahnfried den großartigen Schumann – und gut – zu spielen, ist das eine. Am Ort auf relativ einfache, doch musikalisch hintersinnige und informierte Weise auf den Wagnerianer Mann und die eigentümliche Wirkung der Wagner-Musik um 1900 zu verweisen, etwas Anderes. Großer Beifall also für ein überaus gelungenes Konzept-Programm und dessen Interpreten.
Frank Piontek, 25. August 2025
Musik bei den Buddenbrooks
Haus Wahnfried, Bayreuth
24. August 2025
Sibylle Bertsch, Konzeption und Vortrag
Cosmin Boeru, Klavier
