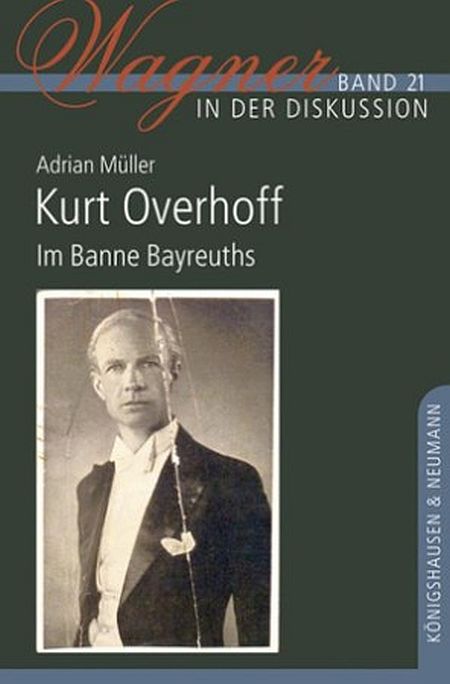
„Wielands grosse Liebe zu Richard zündete über seinen Verstand als er Richards Partituren begreifen lernte. Und das wiederum durch Overhoff. Er allein öffnete erst das Tor, durch das Wieland zum Grossvater hindurchtreten konnte“ – und, möchte man ergänzen, zu dem bedeutendsten Wagnerregisseur zwischen 1951 und 1966 werden konnte, der eine ganze Epoche der szenischen Wagnerinterpretation bestimmte und befeuerte, darüber hinaus zu einem der bedeutendsten Opernregisseure der zweiten deutschen Nachkriegszeit avancierte.
Dass es Overhoff war, der dem mit 23 Jahren nicht mehr ganz jungen Wagnersproß das Rüstzeug für dessen spätere Arbeit in die Hand gab, hat Gertrud Wagner, die Frau und Witwe Wieland Wagners, genau beobachtet. Kurt Overhoffs Ruf aber litt nicht zum Wenigsten unter dem Fluch, den der Atridensohn über ihn verhängte, als er sich – vor den frühen Biographen und der Mitwelt – als Originalgenie ausgab. Erst 1970 hat Geoffrey Skelton in seiner Wieland-Biographie auf Overhoffs Bedeutung hingewiesen – der Lehrer sollte da noch 16 Jahre leben. Dass Overhoff nach dem Maler Ferdinand Staeger die wichtigste Persönlichkeit in Wielands Lehrjahren war, konnte man dann immerhin in Berndt W. Wesslings Wieland-Buch relativ genau nachlesen, bevor Ingrid Kapsamer 2010 in ihrer Monographie über Leben und Werk des Wagnerenkels die nötigsten Auskünfte über den Mann gab, der damals wohl fast nur nach seinen Wagnerbüchern beurteilt wurde – wenn überhaupt. Dass er 1978 eine äußerst gründliche Arbeit über „Elektra“ veröffentlichte, war vermutlich nur den Freunden von Richard Strauss aufgefallen. Wenn Adrian Müller nun in einem ersten Buch über Kurt Overhoff die Bedeutung gerade dieser Schrift für das Denken des Musikers und Musikphilosophen herausarbeitet, erfährt man nicht zum letzten Mal, dass Overhoff mehr, als es für ein Leben ausreichen würde, übel mitgespielt wurde: nicht allein von Wieland und Winifred Wagner.
Dass Overhoff nicht nur deshalb interessant ist, weil er das seltsame Glück hatte, Wieland Wagner in das Werk seines Großvaters einzuführen, duldet nach der Lektüre des Buchs keinen Zweifel. Als Komponist, Dirigent, Autor und Lehrer hat er genügend Spuren hinterlassen, um als markante Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts anerkannt zu werden – und dies vielleicht nicht obwohl, sondern weil er mit seinen (wenigen) Werken und Publikationen stets quer stand zum Zeitgeist, zumindest zu jenem, der als „modern“ oder (hier beginnen schon die Schwierigkeiten, Overhoff gerecht zu werden) „modernistisch“ galt. Müller konnte, versehen mit dem reichhaltigsten Quellenmaterial aus öffentlichen und aus Privatarchiven, eine Arbeit über Overhoff vorlegen, die ihm sine ira et studio in Kritik und Anerkennung gerecht zu werden sucht. Wieland-Anhänger werden glücklich sein, die Arbeit des Älteren derart genau beschrieben zu finden, Opern- und Musikfreunde erhalten einen Blick in die deutsche und österreichische Musikgeschichte zwischen dem Beginn des 20. Jahrhunderts und der frühen Nachkriegszeit; nach den frühen 50er Jahren spielte Overhoff aufgrund seiner Weigerung, sich irgendeiner Moderne anzudienen, kaum noch eine Rolle auf den Podien. Müller betrachtet seine Figur als „musikhistorischen Gegenstand“ und betreibt gleichzeitig Quellenkritik, denn Overhoffs eigenen Aussagen – den Texten eines immer wieder in Depressionen abstürzenden, labilen und geschädigten, wenn auch hochbegabten Menschen – ist nicht immer zu trauen. Auch deshalb berührt die breit dokumentierte Geschichte seiner Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken so stark: weil Overhoff auch im Banne seiner Psyche stand, die wiederum immer wieder von außen irritiert wurde. Dass das Haus Wagner, zumindest bis 1966, Overhoff bei anderen Intendanten und Opernhäuser durch Hinweise auf seine angebliche Arbeitsunfähigkeit und seine Aufenthalte in diversen Kliniken mobbte, ist eine Vermutung, die nicht allein von Overhoff geäußert werden konnte.
„Im Banne Bayreuths“? In der Tat: Wurde Overhoff schon kurz nach der Gründung „Neu-Bayreuths“ von Wieland aus Bayreuth regelrecht herausgeschmissen, so zeigen sich die deutlichsten Spuren der Overhoffschen Pädagogik in Wieland Wagners Anmerkungen zu seinen Regiearbeiten und Figureninterpretationen, weniger in seinen Bildern, die Overhoff gemäß seiner Theorie von der Dominanz des szenisch Konkreten bei gleichzeitiger klanglicher Transzendenz viel zu abstrakt fand. Erst 2017 hat Arne Stollberg in einem Vortrag beim Bayreuther Wieland-Symposion auf die Spuren der Overhoffschen Tristan-Analyse in Wielands Arbeiten aufmerksam gemacht. Nun aber versteht man, mit Müllers Buch im Gepäck, erst eigentlich, auf welchen Grundlagen Overhoffs Überzeugung des gesamtkunstwerklichen Charakters der Wagner-Partituren (und der Opern von Richard Strauss) basierte. Philosophisch wurde er von Karl Jaspers und dessen „Chiffern“ geprägt, in seiner genauen Art und Weise, Musik zu deuten, vom Komponisten Hermann Hans Wetzler. In seiner „Elektra“-Arbeit hat er das ganzheitliche Prinzip seiner Partituranalysen beispielhaft veröffentlicht; Müller definiert die drei unabdingbar zusammenhängenden Konstanten Musik, Psyche und Bühne, um von hier aus Overhoffs (und Wielands) Ansatz darzustellen, wobei der musikalische Teil mit den Kategorien des Symbols, des Intervalls, des Motivs, des Einzeltons, der Harmonik und der Synästhesie beschrieben wird: mit schönen Einzelbeispielen aus dem „Lohengrin“, dem „Tristan“ dem „Ring“ und „Parsifal“, den Mittelstücken zwischen Mozart und Strauss. Dessen Enkel wurde übrigens auch kurz nach dem Krieg von Overhoff unterrichtet, wobei das Ehepaar Overhoff im späteren Sterbezimmer des „Elektra“-Komponisten wohnen durfte.
Der Biograph zeichnet den Berufsweg des Wiener Musikers nach, dessen Qualifikationen im Korrepetieren, Partiturspielen, Transponieren, ökonomischen Dirigieren und präzisen Nachvollzug des Notentexts schon früh erkannt wurde; dass Furtwängler den jungen Mann förderte, verwundert nicht. Nach Stationen an den Theatern in Köln, Ulm, Münster, der Wiener Staatsoper (für Overhoff ein „Sanatorium der Hoffnungslosen“) und Koblenz kam Overhoff 1931 nach Heidelberg, wo er 1935 zum GMD ernannt wurde und nach acht höchst fruchtbaren Jahren als Konzert- und Operndirigent in eine tiefe Krise geriet, die sich privaten (einer fatalen Eheschließung) und politischen Problemen (Overhoffs Großmutter war Jüdin, er selbst bis fast zuletzt ein überzeugter Hitler-Anhänger) verdankte. Ab 1940 war er dann – nach Aufenthalten in drei Kliniken, die zum Teil von Direktoren geleitet wurden, die der Leser nur als Verbrecher an der menschlichen Seele bezeichnen kann – in Wahnfried angestellt. Dass Overhoff nicht mehr an seine Heidelberger Stelle zurückkehren konnte und auch später keine Position bekam, die ihm angemessen gewesen wäre, lag – die Quellen lassen kaum einen anderen Schluss zu – neben Wieland auch an Winifred Wagner, die 1940 bei den Heidelberger Obrigkeiten dafür sorgte, dass Overhoff dort nicht mehr das Pult betreten konnte. Nach dem 2. Weltkrieg leitete er für kurze Zeit das Bayreuther Symphonieo-Orchester, das im Festspielhaus gastierte und schon 1948 aufgelöst wurde, 1949 übernahm er die Leitung des Philharmonischen Chors Bayreuth, aber auch damit war es bereits 1952 zuende. Diesmal geriet Overhoff, weil der Humanist sich für eine vom späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann initiierte Petition gegen die Wiederbewaffnung einsetzte und den Deutschen Kulturbund unterstützte, in den Fokus der Kommunistenjäger. Als Overhoff nach einigen Jahren zum Professor am Salzburger Mozarteum ernannt werden sollte, setzten sich zwar seine Studenten für ihn ein, die ihn aufgrund seiner überragenden musikalischen und pädagogischen Fähigkeiten so liebten wie seine Studenten in Texas (wo er 1966 die Ehrenbürgerwürde der Stadt Lubbock verliehen bekam!), aber die Instanzen verzögerten so lange den bürokratischen Prozess, dass er 1968 lediglich zum außerordentlichen Professor ernannt werden konnte. Gleichzeitig schlugen alle Versuche fehl, seine einzige vollendete Oper „Mira“, die wenigstens ein paar Mal, doch immer nur unter seiner eigenen Leitung, in kleineren Häusern aufgeführt werden konnte, in einer überarbeiteten Fassung auf eine Nachkriegsbühne zu bringen. Overhoff hat selbst gewusst, dass ihn seine kompromisslose Haltung für die Tradition und gegen die moderne Kunst, der er nicht zu folgen bereit war, als Opfer der Wahrhaftigkeit zur Erfolglosigkeit verdammte: „womit“, schrieb er 1985 in seiner Autobiographie, „Wieland Wagners rücksichtslose Sabotage meiner Karriere nicht entschuldigt ist“. Overhoff hätte, auch dies wird aus dem sorgfältig recherchierten Buch klar, zumindest als Kapellmeister oder GMD auch noch nach 1945 in der ersten Reihe stehen müssen; wenn auch allein als Sachwalter eines älteren oder musiksprachlich konservativeren Repertoires. Ersichtlich wird auch der Umstand, dass es bei Charakteren wie Overhoff schwierig ist, von einer Schuld in Sachen NS-Verfallenheit zu sprechen. Seine Analysen der Musik, die er während der 12 Jahre auch in Bezug auf Wagners Regenerationsthesen vorgelegt hat, zeigen keinen NS-Ideologen sondern einen Denker am Werk, der die Musik auf der Basis des Humanismus deutete. Da erscheint es eher wie ein gespenstischer Treppenwitz der Geschichte, dass zu den Grundlagen Neu-Bayreuths nicht nur der nachträgliche Einfluss Overhoffs, sondern zumindest eine Bildidee Adolf Hitlers gehörte: die Nornenszene in Wielands „Ring“ von 1951 nahm einen Vorschlag des einstigen Wielandförderers auf, der sich nicht im Geringsten für Overhoff interessierte, auch wenn das Propagandaministerium fast alles dafür tat, den Dirigenten 1940 in Heidelberg zu halten, damit Wieland dort eine Bühne ganz für sich allein haben konnte. Bekanntlich konnte er erst in Altenburg einen seiner ersten beiden „Ringe“ und einige andere Inszenierungen unter Overhoffs Schirmherrschaft realisieren.
Für Opernfreunde dürfte der neue Band vor allem deshalb interessant sein, weil die Entstehungs- und Aufführungs- wie Nichtaufführungsgeschichte der Overhoff-Opern so genau wie möglich erzählt wird. Die Mysterienoper „Mira“, die 1925 in Essen uraufgeführt wurde, wird zudem in einem 75 Seiten umfassenden, vergleichenden Notenanhang porträtiert. Von den „Freiern“ nach Eichendorff liegt nur die Ouvertüre vor, nachdem der Komponist die Sinnlosigkeit einer Operndramatisierung eingesehen hatte, von „Shiwas Tod“ nur ein kurzes Motiv. Liest man, dass sich Overhoff mit dem Textlieferanten der „Mira“ über Änderungen zerstritten hat, woran eher der Librettist als der Musiker schuld war, wundert man sich angesichts von Overhoffs Karriere kaum noch: eher über das Ansinnen der deutschen Okkupanten, Overhoff 1938 zum Direktor der Wiener Staatsoper zu machen; zu mehr als einem Dirigat des „Fliegenden Holländers“ sollte es am Pult des Hauses am Ring nie kommen. Weitere Szenen sind ebenso faszinierend: die köstlichen Beschreibungen, die Overhoff 1920 über Richard Strauss und später über Siegfried Wagner notierte, die Tatsache, dass der Eingangschor aus Hugo Wolfs Opernfragment „Manuel Venegas“ in Koblenz uraufgeführt wurde, aber auch die Spielplanpolitik, die die Ulmer und Heidelberger Theater Ende der 20er und zu Beginn der 30er Jahre auszeichnete. Wer wissen will, welche Werke Overhoff dirigiert hat, findet im Anhang auf nicht weniger als 58 Seiten ein komplettes Verzeichnis aller Stücke und ermittelten Aufführungsdaten. Ein Werkverzeichnis mit genauen Standorten von Partituren und Aufnahmen, ein Schriftenverzeichnis einschließlich der vielen unveröffentlichten Texte und eine Übersicht über existierende Tonaufnahmen in Rundfunkarchiven bilden schließlich die Basis für jede weitere quellenmässige Beschäftigung mit dem Werk Kurt Overhoffs.
Zum kompositorischen Werk gehört übrigens auch eine Gruppe von Stücken, die zu Overhoffs verquerer Biographie glänzend passen: vier Klavierkonzerte, die er als Ghostwriter für den Pianisten Kurt Leimer schrieb. Wer wissen will, wie man zusätzlich zu drittklassigen Klavierübungen eines guten Pianisten einen Orchestersatz schreibt, der sich um das substanzlose Geklimper herumrankt, und wie derartige Machwerke bei den zeitgenössischen Musikfreunden als „Meisterwerke“ passieren können, erhält bei Müller genügend Auskunft. Interessanterweise wurden die Konzerte damals von Karajan, Stokowski und Cluytens aufgeführt bzw. eingespielt – diese ausgesprochen dumme Musik kann man sich heute noch auf Youtube anhören; der Wikipedia-Eintrag über Kurz Leimer erwähnt allerdings mit keinem Wort, dass diese seltsamen Stücke, abgesehen vom geistlosen Herumhämmern auf dem Klavier, von Overhoff geschrieben wurden, der sich mangels anderer Arbeitsmöglichkeiten dafür vom Auftraggeber ausbeuten ließ, um „Kurt Leimers Klavierkonzerte“ zu schaffen.
Dass seine eigenen wenigen Werke nach 1945 kaum eine Chance hatten, wahrgenommen zu werden, war für Overhoff wohl, neben den beruflichen Erfolgen und Misserfolgen, die größte Katastrophe seines Künstlerlebens, wie er 1986, kurz vor seinem Tod, einem Schüler, dem Dirigenten Gustav Kuhn, in einem Brief andeutete. Wer dem Komponisten Kurt Overhoff gerecht werden will, hat dazu die Chance, wenn er eine der seltenen Exemplare der einzigen Schallplatte erwirbt, die Overhoff jemals aufnahm: mit einem eigenen Werk, dem 1962 komponierten „Bayreuther Bilderbogen“. Hört man diese kurzweilige fünfsätzige Suite mit lyrischen Bildern aus dem alten Bayreuth, könnte man sie für ein Werk der späten, tonal verpflichteten Romantik von maximal anno 1930 halten – die Musik ist gut gemacht, die Nichtbeachtung durch die Avantgarde verständlich. Sie klingt ein wenig wie Strauss; darauf angesprochen, meinte der Komponist der Oper „Mira“, dass es doch gut sei, als vermeintlicher „Epigone“ eines Richard Strauss, also auf höchstem Niveau zu komponieren. Wie differenziert Overhoff, der sich in Sachen Harmonielehre exzellent auskannte, aber auf die Bi- und Polytonalität der „Elektra“ sah, die gemeinhin als Wendepunkt in Straussens Moderne gilt: auch das kann man in Müllers Buch nun nachlesen.
Begraben wurde Overhoff übrigens in Bayreuth: kurz nach einer geplanten Übersiedlung in die Stadt am Roten Main, die der Tod verhinderte. Ausgerechnet hier, wo er zutiefst gedemütigt worden war, wollte er nach seiner Salzburger Emeritierung leben. Im Banne Bayreuths liegt er noch heute, also in der Nähe von Liszt und Jean Paul, aber auch seines Quälgeists Wieland Wagner. Die Frage bleibt: Warum wollte er ihm noch im Tode nah sein? Honni soit, qui mal y pense. Dem unglücklichen Musiker und Lehrer, der endlich einen Biographen gefunden hat, bleibt zumindest dieses Geheimnis.
Frank Piontek, 11. Mai 2023
Adrian Müller: Kurt Overhoff.
Im Banne Bayreuths (Wagner in der Diskussion, Bd. 21).
Königshausen & Neumann. 511 Seiten.
29 Abbildungen, 18 Notenbeispiele im Text, 75 Notenseiten im Anhang.
Würzburg 2020. 48 Euro.
