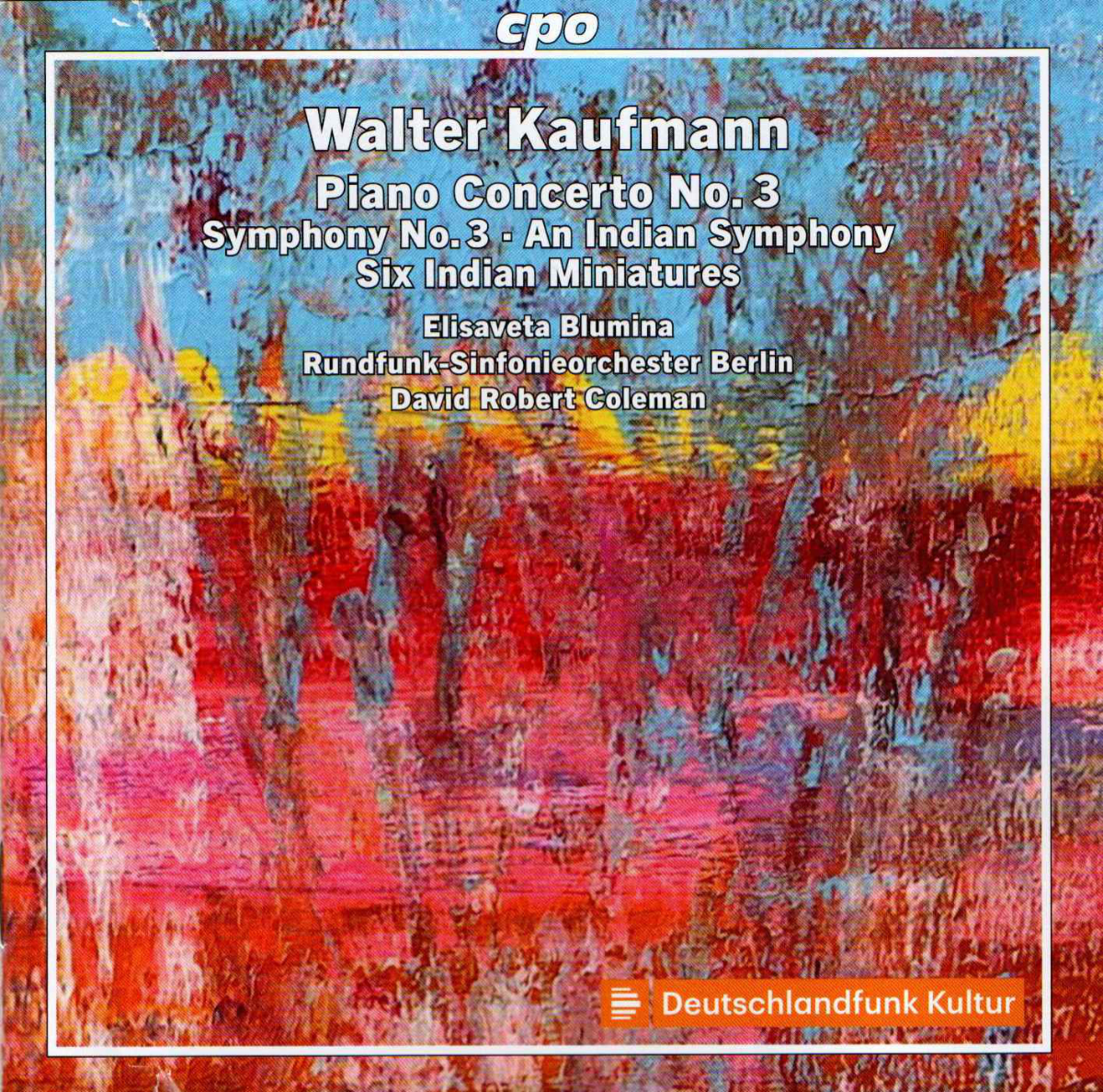
„Die Leute reden alle von Musik, reden daran vorbei, die wissen gar nicht, was das für ein Feuer ist, das einen Menschen vollständig verbrennen kann“ – so beschreibt der Musiker Walter Kaufmann 1927 sein Umfeld als Student an der Karls-Universität in Prag. Da ist der gebürtige Karlsbader gerade 20 Jahre alt und hat bereits in Berlin die Meisterklasse für Komposition bei Franz Schreker ebenso absolviert, wie ein für ihn noch prägenderes Studium beim Musikethnologen Curt Sachs. Schnell nimmt die Karriere Kaufmanns Fahrt auf, er komponiert unter anderem Kammermusik, Opern und Operetten, schreibt Filmmusik für die UFA. Er wird Assistent von Bruno Walter an der Deutschen Oper Berlin (damals Charlottenburger Oper), arbeitet mit Ralph Benatzky und dirigiert etliche Orchester in Berlin und seiner tschechoslowakischen Heimat.
Überhaupt bewegt er sich in überaus illustren Kreisen, trifft in Berlin Leo Baek und ist bei Albert Einstein zu Gast. Sein Prager Domizil ist ein Zimmer bei Franz Kafkas Mutter, dort wird Kaufmann Teil der Gruppe um Franz Kafka, Max Brod und Franz Werfel, heiratet schließlich Kafkas Nichte Gerty Herrmann. Seine langjährige Freundin Mimi Grossberg beschreibt seine fortwährende Produktivität in ihrem Tagebuch: “Er zieht aus allen Taschen beschriebene Notenblätter heraus, singt mir Motive vor, erzählt, dass er hier an einer Symphonie arbeitet, deren erster Satz bereits fertig ist“.
Nebenbei schreibt er seine Dissertation „Die Instrumentation Gustav Mahlers“, reicht sie 1934 an der Prager Karls-Universität ein und zieht sie wieder zurück, nachdem sich sein Doktorvater als strammer Nazi entpuppt. Mit der Erkenntnis, dass die Situation für Juden zunehmend untragbar wird, finanziert er seine Reise ins indische Exil mit dem Rechteverkauf seiner Operette „Die weiße Gräfin“. Dort angekommen, gründet Kaufmann The Bombay Chambre (!) Music Society, in der er auch mit Mehli Mehta, dem Vater von Zubin Mehta, musiziert. Zunächst führt er viele europäische Werke erstmals in Indien auf. Geprägt aber auch durch das Studium bei Curt Sachs, vertieft er sich in die klassische indische Musik, die Ragas (melodische Klangstrukturen der klassischen indischen Musik) und lässt diese in seine Kompositionen einfließen. Es folgen produktive Jahre, in denen er für sein Ensemble Musik unterschiedlichster Couleur schreibt; schließlich wird Kaufmann beim staatlichen Rundfunksender All India Radio angestellt, dessen noch heute populäre Erkennungsmelodie er komponiert.
Doch auch das lebensrettende Indien ist nur eine Zwischenstation. Nach 12 Jahren Exil, Leiden unter tropischer Hitze und der Erkenntnis, dass er „… kein sehr großes, aber bequemes Einkommen, viel, viel Arbeit, noch mehr Intrigen und Stunk und wenig Aussichten auf eine bessere Zukunft“ habe, bricht Kaufmann mit seiner Familie 1946 zunächst nach London auf. Eine Rückkehr nach Deutschland oder in seine Heimat ist ausgeschlossen, Familie und Freunde sind überwiegend dem Naziterror zum Opfer gefallen, Arbeitsangebote bleiben aus.
Schon bald schifft er sich nach Kanada ein und landet schließlich in Winnipeg, wo er Leiter des örtlichen Orchesters wird. Allein über seine dortige Aufbauarbeit für das Orchester und die gesamte Musikszene, seine überaus umfassende Konzerttätigkeit, seine Erstaufführungen europäischer, auch eigener Kompositionen und das Engagement berühmter Künstler ließe sich viele Seiten schreiben. Doch auch dieser Aufenthalt ist nicht von Dauer; die Idee, nach Israel auszuwandern, lässt sich nicht realisieren, aber die verliehene Ehrendoktorwürde der Universität Bloomington 1955 veranlasst Kaufmann, in die USA zu übersiedeln und an eben jener Uni einen Lehrstuhl für Musikethnologie zu besetzen.
Seine Kompositionstätigkeit nimmt deutlich ab, vielmehr widmet er sich dem Schreiben von wissenschaftlichen Büchern zur Musikgeschichte Indiens und Chinas. Deutlich resigniert schreibt er 1979 seinem Freund Hans Moldenhauer: „Allow me to explain: when I was a youngster in Karlsbad and in Prag and in Berlin, I believe I was considered to be a gifted young composer. (…) Then began the great darkness over Europe, I went to India and there my writing changed. The picture of the Heimat became dim, new impressions and a new Job as Music Director at All India Radio, caused me to change course and write things that please audiences of Bombay (and they are not always very musical). And then, (…) when I went for a year to England, / had not enough chance to live myself into a new Heimat, then Canada, where it happens a bit (Pemhina Road; Skizze: Streichquartett) and then in 1956/7 Bloomington. Then, I had to sit still, work for my job and I began writing books“. Walter Kaufmann stirbt am 8. September 1984 in Bloomington.
Nach Europa ist der Komponist nie wieder zurückgekommen und seine Musik ist nahezu vollkommen in Vergessenheit geraten. Erst seit wenigen Jahren wird sein Werk nun zugänglich und kann auf CD wiederentdeckt werden. Einer Aufnahme von Kammermusik mit dem ARC-Ensemble bei Chandos folgt nun beim Label CPO in Zusammenarbeit mit Deutschlandradio Kultur die Ersteinspielung des Klavierkonzertes No. 3, seiner dritten Sinfonie, der Indischen Symphonie und der sechs indischen Miniaturen. Das Solistenkonzert und die Miniaturen entstehen in seiner kanadischen Zeit, die beiden Sinfonien während der Jahre im indischen Exil. Das Klavierkonzert von 1950 ist dabei noch sehr der europäischen Tradition verpflichtet. Die beiden Ecksätze sind heiter bis rhythmisch zackig, lassen gelegentlich an Filmmusik wie von „Tod auf dem Nil“ (1. Satz) bis Strawinskys Petruschka oder Le Sacre denken (3. Satz). Den 2. Satz prägt die sehr deutliche Umsetzung der ersten Takte der No. 4 „Oft denk‘ ich, sie sind nur ausgegangen“ aus Mahlers Kindertotenliedern in verschiedenen Variationen. Man mag hier an eine Reminiszenz an seine Doktorarbeit denken.
Die Pianistin Elisaveta Blumina, Expertin für die Musik jüdischer Komponisten aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, wirft sich leidenschaftlich in den anspruchsvollen Klavierpart, arbeitet vor allem im 2. Satz das melancholische Thema in aller Schönheit, aber auch Traurigkeit sanft heraus. Kontrastreich und zupackend hingegen ist ihre Interpretation der beiden Ecksätze. Gern hätte man ihr und dem adäquat begleitenden Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter David Robert Coleman länger zugehört. Aber das gesamte Konzert dauert nur knapp 22 Minuten.
Überhaupt sind die Kompositionen von recht übersichtlicher Länge. Und so kann man sich des Gefühls nicht erwehren, als seien diese Werke Ausdruck der vielen, in Kaufmanns Kopf ständig aufploppenden Ideen und Gedanken, die er von dort in schneller Folge zu Papier gebracht hat, atemlos und ohne sich mit einer Melodie lange aufhalten zu wollen. Die erzwungene Rastlosigkeit in seinem Leben scheint hier einen Niederschlag zu finden. Gleichzeitig bedeutet dies aber nicht im Geringsten eine Minderung an Qualität dieser Kompositionen.
Das liegt auch an der Begeisterung des Dirigenten der Aufnahme für diese Musik, die er auf das prächtig aufspielende Orchester überträgt und es in den Strudel an Farbenreichtum und Rhythmik mitreißt. Sowohl in der 3. (1936) als auch in der Indischen Symphonie (1943) lässt es sich wunderbar in exotischen Klängen schwelgen, wobei diese niemals plakativ und aufgesetzt erscheinen, sind sie doch von großer Kenntnis der indischen Ragas geprägt. Aus der Mischung beider Kulturen entsteht ein ganz neues Klangerlebnis voller Überraschungen, Rhythmuswechsel und Farbigkeit. „Zu kurz!“ möchte man nach beiden Werken (knapp 19 bzw. 16 Minuten Spielzeit) rufen und ist dankbar, dass die Protagonisten die sechs indischen Miniaturen noch zugeben, jede auf ihre Weise ein kleines, blitzendes Juwel. Was für eine Wiederentdeckung dieses sehr besonderen Komponisten und Menschen! Da freut man sich schon auf weitere Veröffentlichungen, sehr gern mit diesem Orchester unter David Robert Coleman, denn das kann und darf ja nur der Anfang sein!
P. S.: Wer mehr über das außergewöhnliche Leben von Walter Kaufmann und seinen Weg, der doch dem so vieler Juden in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts gleicht, erfahren möchte, dem seien die Ausführungen von Agata Schindler ans Herz gelegt: https://www.musau.org/assets/Uploads/OEGMW/MusAu-Printausgabe/MusAu-20-2001/MusAu-20-2001-10-Schindler.pdf (Stand 12.Juni 2024)
Regina Ströbl, 13. Juni 2024
Walter Kaufmann:
Klavierkonzert Nr. 3,
Symphonie Nr. 3,
An Indian Symphony
Six Indian Miniatures
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
David Robert Coleman
CPO Pro Classics
555 621-2
