Eigentlich ist die Bilanz zu den diesjährigen Bayreuther Festspielen noch nicht an der Reihe. Weitere Berichte zu einzelnen Produktionen sind noch in Arbeit. Aber unser Autor hat sich bereits sämtliche Produktionen der Premierenwoche angesehen und präsentiert dazu eine Nachlese, die wir aus Gründen der Aktualität in einer Extra-Ausgabe der Spielzeitbilanzen einschieben.
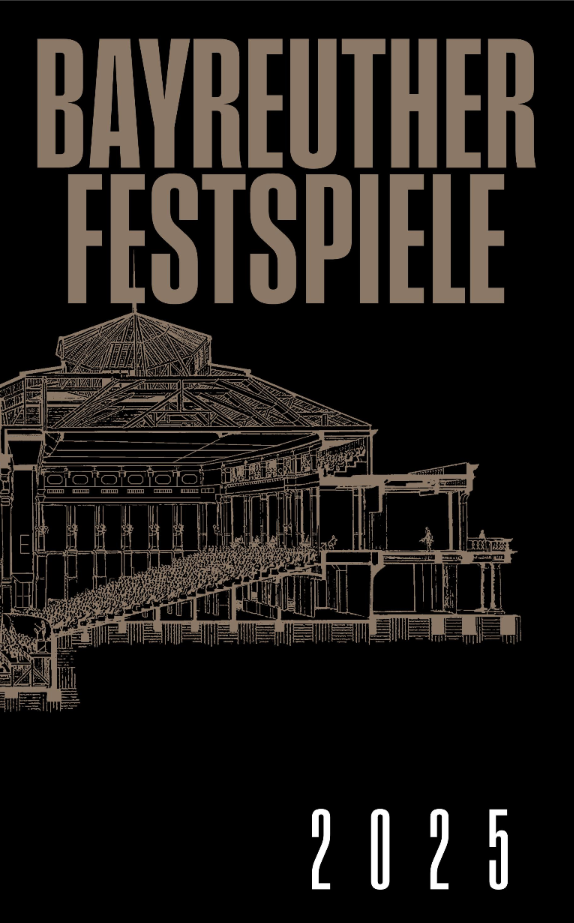
Chorleistung:
Die im Frühjahr heftig schäumenden Wogen um die Neuaufstellung des Bayreuther Festspielchors haben sich zwar gelegt, aber in der Rückschau auf die Premierenwoche doch einige Spuren hinterlassen. Notwendige Sparmaßnahmen veranlassten Katharina Wagner, die Stammbesetzung von 137 Mitgliedern auf 100 zu reduzieren und für große Choropern die Lücken mit Gästen zu füllen. Zudem müssten sich alle Bewerberinnen und Bewerber für jede Saison neu bewerben. Änderungen, die einige als zeitgemäße Reformen goutierten, bei vielen aber auch heftige Proteste auslösten. Manch einer befürchtete, dass die stabile Homogenität des Chors gefährdet sei. Dass der langjährige Chordirektor Eberhard Friedrich in dieser Zeit seine Kündigung einreichte, obwohl dessen Vertrag am 27. August ohnehin ausgelaufen wäre und eine Verlängerung von beiden Seiten nicht vorgesehen war, hat die Situation nicht entspannen können.
Auch nicht für seinen Nachfolger Thomas Eitler de Lint von der Leipziger Oper. Ein erfahrener Chorleiter, der als ehemaliger Chorassistent mit dem Betrieb und den spezifischen Anforderungen der Bayreuther Festspiele bestens vertraut ist. Gleichwohl kam es einer Herkulesaufgabe gleich, in seiner ersten Spielzeit als Leiter mit dem neu aufgestellten Chor gleich drei große Choropern stemmen zu müssen: Die Meistersinger von Nürnberg, Parsifal und Lohengrin. Hinzu kamen noch kleinere Auftritte in der Götterdämmerung und dem Tristan. Die klanglichen Probleme im Parsifal mit seinen räumlich versetzten Höhenchören sind bekannt und haben Eitler de Lint auch nicht in nennenswerte Bedrängnis bringen können. Gefürchtet sind und bleiben komplexe Chorpartien wie die der Prügelfuge in den Meistersingern und der achtstimmigen Passagen im ersten Lohengrin-Akt.
Der Lohengrin stellt möglicherweise die höchsten Ansprüche an den Chor. Und selbst ein Christian Thielemann, der erfahrenste Dirigent auf dem Grünen Hügel, hatte am Premierenabend Probleme, den Apparat zusammenzuhalten. Wie auch Daniele Gatti am Eröffnungsabend mit der Prügelfuge der Meistersinger. Unstimmigkeiten, die sich im Laufe der vierwöchigen Saison noch bereinigen lassen dürften. Ein wenig Zeit sollte man dem neu gemischten Chor und seinem neuen Leiter schon gewähren. An der legendären, immer wieder überwältigenden Durchschlagskraft des Chores hat sich nichts geändert. Wenn das so bleibt, können die Festspiele eines ihrer noch wenigen verbliebenen Alleinstellungsmerkmale inmitten der immensen internationalen Konkurrenz retten. Denn die Qualität des Festspielchores hat bisher allen Krisen der langen Festspielgeschichte standgehalten.
Dirigenten und Sänger:
Was sich vom Niveau der Sänger, Dirigenten, geschweige denn der Regisseure nicht so einhellig behaupten lässt. Wenn schon die Namen Daniele Gatti und Christian Thielemann erwähnt werden, lohnt sich ein Blick auf das bisweilen dramatische Gefälle zwischen Höhen und Tiefen am Dirigentenpult. Die Rückkehr von Christian Thielemann auf den Grünen Hügel mit der Wiederaufnahme des Lohengrin wurde zu einem Triumph für den nach Felix Mottl einzigen Dirigenten, der alle zehn Werke des Bayreuther Kanons im Festspielhaus geleitet hat. Wie sehr er sich mit der Akustik auskennt, zeigte sich im souveränen Umgang mit der Dynamik, der für die Sänger so wichtig ist. So sensibel wie er trug keiner seiner Kolleginnen und Kollegen die Sängerinnen und Sänger durch den Abend. Niemand musste forcieren und es blieb genug Raum für eine dezidierte Textverständlichkeit. Eine Chance, die allerdings nur Piotr Beczała in der Titelrolle vollauf nutzte. Insgesamt entfachte Thielemann Klangbilder von seidiger Transparenz und Zartheit, wie man sie sich nur wünschen kann. Interessant, dass Thielemann bereits mit seinem Meistersinger-Debüt vor 25 Jahren mit der für dieses Stück nicht gerade idealen Akustik des Festspielhauses so gut zurecht kam wie nur wenige seiner Kollegen.
Davon kann bei Daniele Gatti in diesem Jahr nicht die Rede sein. Zäh und dickflüssig ergoss sich der Klang über die Sänger, so dass selbst ein erfahrener Recke wie Georg Zeppenfeld in der Titelrolle seine vorbildliche Diktion und kluge Phrasierung kaum zur Geltung bringen konnte. Bessere Eindrücke hinterließen Semyon Bychkov im Tristan und Pablo Heras-Casado im Parsifal. Von Weihrauch geschwängertem Pathos hält der Spanier nicht viel. Den Ersten Akt durchschwebt er mit 1 Std. 40 Min. fast so flott wie Hans Zender und Pierre Boulez, die ihn noch unterboten. Und in krassem Gegensatz zu Arturo Toscanini und James Levine, der 2 Std. 15 Min. brauchte. Was natürlich noch nichts über die grundsätzliche Qualität der Dirigate aussagt. So überzeugend Heras-Casado insgesamt auch agierte: Das kühl und rasch abgehandelte Finale des Stücks ließ unter seinen Händen eine dicke Prise an inspirierter Binnenspannung vermissen.
Im Unterschied zu den letzten Jahren stand diesmal nur eine Frau am Pult: Simone Young beim Ring des Nibelungen. Werkerfahren und handwerklich sauber brachte sie manches von der vom Werk ausgehenden Faszination zum Klingen, die man auf der Bühne vermisste. Nicht nur szenisch. Sängerisch scheint sich mangelnde Textverständlichkeit wie ein Lauffeuer auszubreiten. Klaus Florian Vogt als Siegfried, mit Abstrichen auch Catherine Foster als Brünnhilde waren die einzigen Interpreten der großen Rollen, die sich um eine gesunde Diktion bemühten.
Andreas Schager als Parsifal und Tristan erwies sich wieder als sattelfester Routinier, im Tristan allerdings auch als robuster, kraftbetonter Liebhaber, der stimmlich nicht so recht mit der lyrisch ausgerichteten Isolde von Camilla Nylund harmonieren wollte.
Inszenierungen:
Szenisch rangen, wie eigentlich in jedem Jahr, Licht und Schatten um die Dominanz. Oberflächlich banale, letztlich langweilende Lustspielstimmung strebte Musical-Experte Matthias Davids in den Meistersingern an, der Lohengrin erstarrte in der steifen Personenführung von Yuval Sharon und den wesentlich inspirierteren Bühnenbildern von Neo Rauch und Rosa Loy, der Parsifal von Jay Scheib zeigte, dass er auch ohne die ablenkende Bilderflut der AR-Brillen überzeugen kann, und Thorleifur Örn Arnarsson brachte den ohnehin handlungsarmen Tristan stellenweise zum völligen Stillstand. Und Valentin Schwarz‘ umstrittene Inszenierung des Rings ist ein Problem für sich.
Insgesamt eine Melange aus einigen Höhepunkten, viel Mittelmaß und einigen Tiefschlägen. Wie in jedem Jahr.
Die Bilanz zog Pedro Obiera.
