„Wagner: Grinsen, wenn man seinen Namen hört, und Witze über die Musik der Zukunft reißen“. Der Satz aus Gustave Flauberts Wörterbuch der Gemeinheiten wird im anzuzeigenden Band nicht zitiert, aber er könnte sehr gut als Motto der Untersuchung dienen.
Dass Wagner und Frankreich bzw. die Franzosen ein weites Feld sind, muss nicht betont werden. Hier, wo die Phänomene der Wagner-Kritik und -Manie besonders stark ausgeprägt waren und sind, hat sich ein Genre ausgeprägt, das bei uns in dieser Fülle zwar beliebt, aber nicht ganz so populär gewesen ist wie im Nachbarland. Andrea Schneider ist in ihrer 1996 veröffentlichten Dissertation Die parodierten Musikdramen Richard Wagners nur auf knapp 50 deutschsprachige, noch erhaltene und verschollene Werke und Werkchen gekommen, die zeitlich von 1854 bis 1911 reichen – Christian Dammann hat sich nun, Frankreich und Belgien zuwendend, 136 Texten und, in drei Nachträgen, nicht wenigen verschollenen Stücken gewidmet, die zwischen 1860 und 1950 entstanden, wobei der Schwerpunkt auf der Zeit bis 1914, bekanntlich dem ersten Jahr des ersten Weltkriegs und zugleich der lokalen Erstaufführungen des Parsifal, liegt. Danach folgten nur noch acht Parodien, die in Frankreich und Belgien herauskamen. Der Autor ist kein Unbekannter, er hat sich bereits 2018 in Bonjour Lolo! Mit den französischen Lohengrin-Parodien befasst, die zwischen 1886 und 1900 die Bühnen eroberten. Nun also legt er mit einer monumentalen, in die Tiefe und Breite gehenden Monographie nach. In Folies-Richard geht es also um die „französische und belgische Wagner-Rezeption in der dramatischen Opernparodie“, wobei die vermeintliche Einschränkung keine ist. Im Zentrum stehen nun alle jemals für die kleinen Bühnen produzierten Tagesstücke und satirischen Auseinandersetzungen mit den Werken Wagners, die – anders als etwa Johann Nestroys Tannhäuser– und Lohengrin-Veralberungen – Wagner nicht abendfüllend, sondern als Teil von übergeordneten Bühnenstücken, sprich: zumeist Revuen, durch den sprichwörtlichen Kakao zogen. Dammann zeigt nüchtern wie inhaltsreich, anregend wie kritisch, wie sich seit Wagners Pariser Konzerten des Jahres 1860 die Unterhaltungstheater an Wagner rieben, um – das war so gute Pariser und Brüsseler Tradition – mit durchaus verschiedenen Mitteln dem berüchtigten Musiker auf gelegentlich blödsinnige, manchmal auch geistreiche Weise ihre Reverenz zu erweisen. Es ist eine Binsenweisheit, die auch für die Kultur der französischen und belgischen Parodien grundsätzlich galt, dass nur das parodiewürdig ist, was auf seine Weise groß ist, zumindest gerade in den Schlagzeilen steht. Die heute so gut wie vergessenen Parodisten, die lange im Fahrwasser Jacques Offenbachs segelten (das ist eine wichtige Erkenntnis der Arbeit), haben damit nur den Ruhm des Gesamtkunstwerkers befestigt, dem und dessen Musik, auch die des relativ harmlosen und hochmelodiösen Tannhäuser, immer wieder wüste Lärmmacherei, Melodielosigkeit, Maßlosigkeit, Unverständlichkeit, kurz: die totale Hybris unterstellt wurde. Liest man sich die Inhaltsangaben der und die Zitate aus den meisten überlieferten Texte durch, bekommt man schon schnell den Eindruck, dass die „intendierte Verzerrung der Realität“ durch das Mittel der Parodie mit Wagners Werken im Grunde nichts zu tun hat, ja: Wagners Kritik am „welschen Dunst und welschen Tand“, den er in der Schlussrede des Hans Sachs formulierte, und der gern als nationalistisch abgetan wird, weil sich der Komponist hier ausdrücklich gegen die Übernahme französischer Opern auf die deutschen Opernbühnen aussprach (man kann das noch deutlicher in der während des deutsch-französischen Krieges veröffentlichen Kapitulation nachlesen) – diese Kritik erfuhr mit nicht wenigen parodistischen Texten eine chauvinistische Reaktion aus dem Lager jener Franzosen, denen der Nationalismus nie fremd war: eine Kritik aus dem Geist des nicht immer höheren Unsinns. Hier äußerte sich der pure Hass gegen ein Genie, das letzten Endes auch durch die französischen Populisten nicht verhindert werden konnte, auch wenn Wagner seit den 70er Jahren alles dafür tat, dass sein allgemeiner Ruhm in Frankreich noch ein wenig aufgeschoben werden musste.
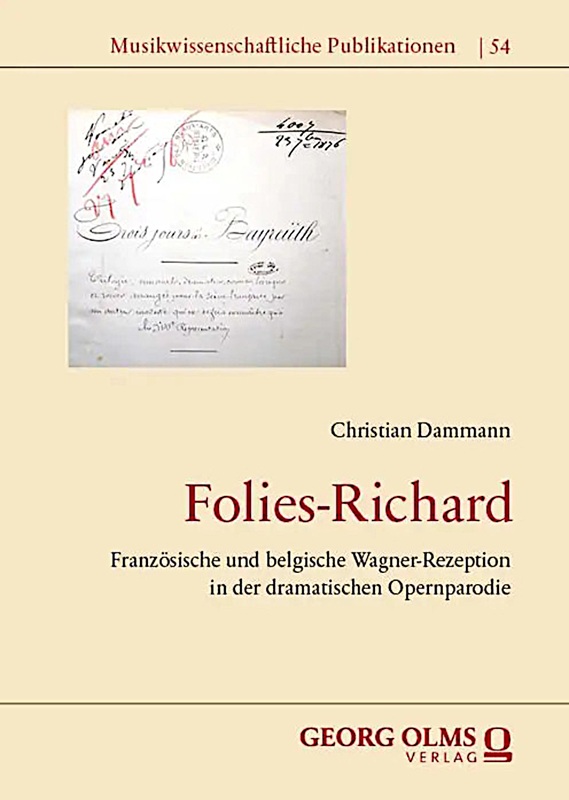
Doch nicht immer entstammten die versammelten Bösartigkeiten und lustigen Kaspereien dem Ressentiment. Dammann fragt im Fall von seltsamen Handlungsführungen zurecht, „was man Autoren von Parodien als fantasievolle Umformung oder Fortspinnung zugutehält und ab wann man bei Veränderungen des Originals von Fehlern oder Missverständnissen sprechen sollte“. Die Verballhornung von Namen, wie sie zum Wesen der Parodie gehören, sind jedenfalls beabsichtigt gewesen – aus „Tannhäuser“ wurde beispielsweise oft ein „Tanne aux airs“ gemacht. Zu Deutsch: „Tanne mit Lügen“ oder „Tanne in der Luft“. Bestimmte Wortspiele bleiben nach wie vor unübersetzbar – doch gelang es Dammann, mit beeindruckendem Spürsinn noch die abgelegensten Anspielungen auf zeitgenössische Ereignisse und Personen zu entschlüsseln, auch viele Originalmusiken, die zumeist verloren sind, zu benennen. Meist wurde nämlich nicht Wagners Musik zitiert oder parodiert. Meist wurden populäre Chansons gesungen, die im Rahmen einer irgendwie gearteten Wagner-Parodie das parodistische Element natürlich verstärkten.
Auf den Bühnen, zumal der Hauptstädte herrschte seinerzeit eine Kultur, die heute ohne weitere Erläuterungen kaum noch verstanden werden kann. Dammann rekonstruierte, wo möglich, die Entstehungsgeschichten der mehr oder weniger kleinen oder großen Dramen, verglich, wo machbar, penibel die Zensurlibretti mit den geänderten Druckfassungen der Texte, erläuterte die Musik, so vorhanden, und wertete alle zugänglichen Pressereaktionen und Nachwirkungen aus. Mit dem Adlerauge für das Wesentliche ordnete er die parodistischen Reaktionen auf die zeitgenössischen Erstaufführungen der Wagner-Werke ein, die teilweise viele gleichzeitige Parodien provozierten. Allein für den Pariser Lohengrin von 1887 kam er auf acht Stücke, nachdem der Tannhäuser und sein „Skandal“ 1861 nicht weniger als ein Dutzend Stücken generierte. Dabei wurde nicht allein das Werk, auch die Aufführungsumstände parodiert – doch seltsamerweise nicht der Protest des Jockey-Clubs, der es gar nicht charmant fand, dass die bestellten Tänzerinnen bereits im ersten, nicht im traditionell dafür vorgesehenen 2. Akt die Bühne betraten. Auch die ersten Bayreuther Festspiele, zu denen laut Zählung ca. 55 Franzosen (und einige einflussreiche Pariser Kritiker – das war entscheidend auch für die Parodien) angereist waren, erfuhren ihre parodistische Überhöhung; dass die Strapazen der ersten Sommerfestspiele persifliert wurden, versteht sich von selbst, ebenso, dass die Wagnerianer als Irre porträtiert wurden. All das ist amüsant zu lesen: die Vendôme-Säule als Blasinstrument, Kanonen als Krachinstrumente, der Ring als wirre „Féerie“, das Abarbeiten an den französischen Übersetzungen der Werke des deutschen Meisters, die Vermischung von Meisters Werken mit anderen, eigenen Opern (wie Ernest Reyers Sigurd), die spezifischen, sich von den französischen merkbar unterscheidenden Vorstellungen im belgischen Grand-Guignol-Milieu, die Umwandlung von Walters Preislied in, natürlich, einen Walzer – all das sind schöne Details aus einem erstaunlich breiten Genre, das stets aufmerksam auf die jeweiligen öffentlichen Wagnertendenzen reagierte: oft in unmittelbarer Nähe zu jenen Häusern, in denen die Wagner-Opern gerade gespielt worden waren oder gespielt wurden. Apropos Häuser: Zu den Vorzügen des Bandes gehört nicht allein der ausführliche Quellen- und Literaturanhang, ein Bühnenverzeichnis und das Register (durchaus keine Selbstverständlichkeit in wissenschaftlichen Werken), auch, im Fließtext, der jeweilige genaue Nachweis der Existenz oder Nicht-Existenz aller Stätten, in denen man die Werke einst zur Aufführung brachte. Der schmale, aber wertvolle Bildteil mit den hochseltenen Illustrationen und Fotos der Parodieaufführungen (Blanche Cernay als Walküre in Ah! La pau… pau… la pau von 1893 – Oh La La…) ergänzt das Material auf schönste Weise, kann so auch als Ergänzung zu Martine Kahanes und Nicole Wilds reichbebildertem Pariser Katalog von 1983, Wagner et la France, benutzt werden.
Soll, ja kann man die von Dammann ausgebreiteten Schätze heute theaterpraktisch wieder heben? Die zeitgenössischen Kontexte machen es, darauf verweist Dammann klar hin, so gut wie unmöglich, eine Parodie von 1861 oder 1887 heute noch so zu spielen, dass ein „normaler“ Besucher daran seinen vollen Spaß hätte. Im Fall der Werke Offenbachs, die ihrerseits mit zeitgenössischen Zitaten gespickt sind, die heute nur noch einem Romanisten, Historiker oder Musikwissenschaftler bekannt sein könnten, haben wir uns daran gewöhnt, Anspielungen, die erst den Witz machen, nicht mehr als solche wahrzunehmen, dies auch nicht zu reflektieren. Die Lösung bestünde, so der Autor, darin, einzelne bedeutende Parodien mit Zusatzerläuterungen in einen Kontext zu stellen, der sie en detail verständlich machen würde, weil sonst der Witz so flöten ginge wie ein parodierter Tannhäuser-Hirte oder eine Figur von 1861 in einer Parodie, die den leicht verständlichen Namen Panne-aux-Airs trägt. Vielleicht wäre es schon sinnvoll, einmal die zeitlich letzte Parodie, Tristoeil et Brunehouille (Paris 1950) vom Texter Jean Marsan und dem nicht ganz unbekannten Komponisten Georges Van Parys, zu reanimieren. Für wahre Opernfreunde müsste die Aufführung ein Leckerbissen sein, auch wenn die Wagner-Parodie „nur“ in einem Akt vor sich geht, während in den anderen Akten die Musik anderer bekannter Komponisten parodiert wird.
Man würde dann vielleicht wieder so grinsen, wie Flaubert es dem ignoranten Small-Talker der Wagner-Zeit in den Mund gelegt hat.
Frank Piontek, 9. September 2025
Christian Dammann:
Folies-Richard. Französische und belgische Wagner-Rezeption in der dramatischen Opernparodie
706 Seiten, 25 Abbildungen
Georg Olms Verlag, 2025
