Nach der ersten Festspielwoche in Bayreuth haben wir in einem Schnellschuss einen ersten Eindruck präsentiert, der notwendigerweise einige Lücken gelassen hat. Nun unternimmt unser Bayreuther Stammkritiker einen vertiefenden Rückblick über das gesamte Festspielprogramm.
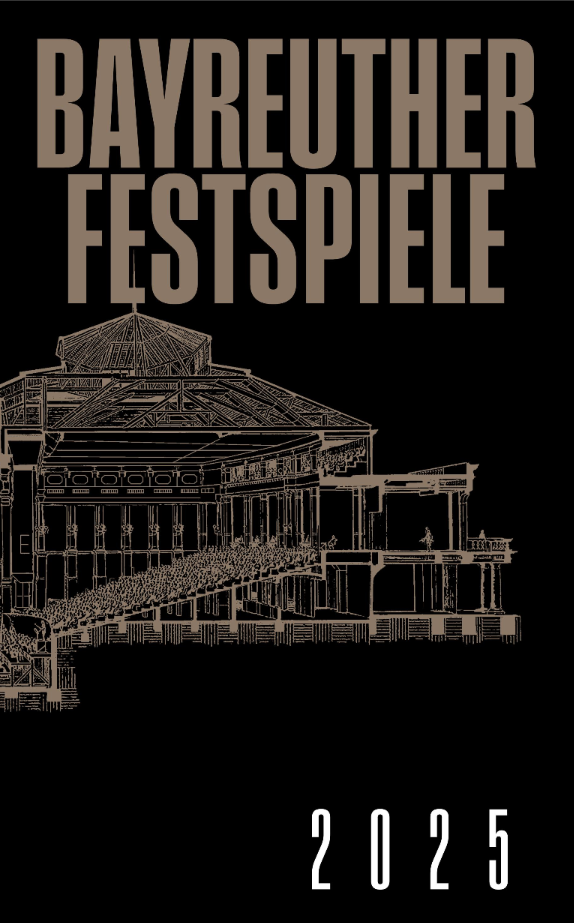
Der Ring – szenisch
Man kann es nicht oft genug sagen: Auch ein Festspielrückblick ist subjektiv bedingt. Nur so lässt es sich erklären, dass die einen, wie der Unterschreibende und nicht wenige andere Festspielbesucher, die letzte Aufführungsserie des gelegentlich inkriminierten „Schwarz-Rings“ musikalisch und szenisch hervorragend, andere die Regie zumindest teilweise fragwürdig, den musikalischen Teil aber glänzend fanden. Die tosenden Applause nach jeder einzelnen Vorstellung sprachen jedenfalls Bände, konnten auch den Eindruck nicht ausräumen, dass es absurd ist, die Sänger und Musiker fast vorbehaltlos zu feiern, die Regie aber dafür abzustrafen, dass sie die Sänger vorteilhaft in Szene setzte. So wird dieser Ring nach dem vierten und letzten Spieljahr auch für mich – nach dem (wie gesagt: subjektive Einschätzung) nur dekorativen Rosalie-Ring, dem thematisch lässigen Flimm-Ring, dem langweilig unterinszenierten Dorst-Ring und dem regielich katastrophalen, bildmäßig jedoch grandiosen Castorf-Ring – einer der inhaltlich und leitmotivisch konsistentesten und schauspielerisch spannendsten Bayreuther Ringe der letzten drei Jahrzehnte bleiben. Die Buhrufe gegen das Regieteam hielten sich ja nicht grundlos in diesem Jahr in Grenzen.
Der Ring – musikalisch
Musikalisch geriet er endlich vollkommen: dank des Festspielorchesters unter Simone Young, dank eines stimmlich erneuerten Olafur Sigurdarson als Alberich, der neuen phänomenalen Erda der Anna Kissjudit, des frischen Siegfried des Klaus Florian Vogt, der überragenden Brünnhilde Catherine Fosters, des hinreißenden Basses Mika Kares als Hagen, des vollkommenen Baritenors Michael Spyres als Siegmund – und Thomas Koniecznys Wotan / Wanderer steht, trotz oder vielleicht gerade aufgrund seines leicht gutturalen Stimmtimbres, im Moment, glaube ich, außer Konkurrenz, obwohl es den besten Wotan nicht gibt und nicht geben kann. Er repräsentiert eben einen etwas anderen, doch immer äußerst starken „Göttervater“.
Meistersinger
Neu im Reigen der Inszenierungen waren 2025 Die Meistersinger von Nürnberg. Um ihr gerecht zu werden, muss man akzeptieren, dass es auch unpolitische Inszenierungen gibt, die die heiter-melancholische Komödie, nicht das Deutschland-Stück herausarbeitet. Obwohl schon die ersten zehn Minuten von Barrie Koskys vergleichsloser Meistersinger-Inszenierung von 2017 witziger waren als die gesamte Neuinszenierung von Matthias Davids, konnte ich mich entspannt zurücklehnen, den einen oder anderen Einfall belächeln, mit Sachs mitleiden und am Ende, im spektakulären Schlussbild mit der einer Hüpfburg ähnelnden Riesenkuh, mich herzhaft über das bunte Volksfest freuen.
Georg Zeppenfeld gab einen edlen, wenn auch stimmlich nicht übermäßig potenten Sachs, wofür auch das unausgeglichene Dirigat Daniele Gattis verantwortlich sein könnte. Michael Spyres war als Stolzing eine Wonne, ebenso die wunderbare Hügel-Debütantin Christina Nilsson als Eva; dies waren meine Favoriten im Meistersinger-Ensemble – und der Chor konnte, hier wie in den anderen Choropern des Sommers, zeigen, dass er unter dem neuen Leiter Thomas Eitler de Lint die alte Qualität erhielt, um mit einem verjüngten Klang das Publikum zu erreichen.
Lohengrin
wurde zum Triumph für den Dirigenten Christian Thielemann; viele Besucher besorgten sich nur deshalb Karten, um Zeuge des Orchester-Ereignisses zu werden. Die Inszenierung spielte da, so mein Eindruck, kaum eine Rolle mehr, obwohl sie – man gewöhnt sich ja bekanntlich in Bayreuth an einiges – in den letzten Jahren an künstlerischer Dignität gewonnen hat, oder anders: Als Alternative zu Schwarzens modernen und Matthias Davids spielerischen (die Treppe des ersten Aufzugs!), zu Jay Scheibs modernistischen Parsifal– und T.Ö. Arnarssons symbolistisch-realistischen Tristan-Bildern (alles Werke der hochbegabten Bühnenbildnerinnen und -bildner) boten Neo Rauch und Rosa Loy auch im letzten Spieljahr „ihres“ Lohengrin (man redet ja nicht grundlos vom Lohengrin Neo Rauchs, nicht vom Lohengrin Yuval Sharons, was aber letztlich ungerecht ist) ein altmeisterliches Bühnenbild, das nach der letzten, umjubelten Aufführung in ein modernes Theatermuseum à la Meiningen gehören würde. Die Sänger wurden weniger gefeiert als der Dirigent, doch mir persönlich gefiel die dramatisch flackernde Elsa der Elza van den Heever gut. Und Piotr Beczala ist ohnehin und zurecht ein Publikumsliebling, während Miina-Lisa Värelä auch bei mir als Ortrud punkten konnte: ein düsteres Licht im Dunkel der Lohengrin-Nacht.
Parsifal und Tristan
Im Parsifal trat Michael Volle erstmals als Amfortas auf – wenn er auf der Bühne steht, ist die Frage, in welcher Inszenierung er agiert, völlig unwichtig. Andreas Schager bot, wie schon 2023, einen kräftigen, doch an entscheidenden Stellen auch leisen Parsifal, so wie er in der Wiederaufnahme des Tristan durchaus differenziert sich aussang. Camilla Nylund gehört für mich nach der ganz anders gearteten Waltraud Meier und der balsamisch wie brillant singenden Catherine Foster zu den großen Bayreuther Isolden der jüngeren Vergangenheit; dass ihre Stimme bei Wagner-Aficionados umstritten ist, weiß ich, doch kümmert’s mich nicht. Die Inszenierung kam bei größeren Teilen des Publikums nach wie vor nicht sonderlich gut an, doch konnte man, wenn man sie einzelnen Besuchern empathisch erklärte, den Eindruck gewinnen, dass sie danach zumindest intellektuell verstanden wurde. Für mich ist sie – subjektiv, subjektiv… – die spannendste und bildmächtigste, durchdachteste und psychologisch feinste Bayreuther Tristan-Inszenierung seit Heiner Müllers und Erich Wonders Regie- und Bildertheater.
Das waren so meine Höhepunkte des Bayreuther Festspiel-Sommers, der keinen einzigen schlechten Abend bot, wenn mir auch die Sängerleistungen, natürlich, mal mehr, mal weniger gelungen schienen und diese Regie spannender, jene zurückhaltender wirkte. Die Hauptsache aber war immer gleich: die Intensität, mit der die Musiker – ausnahmslos alle Musiker – die Wagnersche Sache vertraten.
Frei nach Wagner: Ein glücklicher Sommer.
PS: Leider waren 2025 nicht allein für mich, auch für etliche Rezensentenkolleginnen und -kollegen mehrere Postscripta nötig, um das Verhalten einzelner botokudenhafter (wie Hugo von Hofmannsthal gesagt hätte) Festspielbesucher im Haus zu kritisieren. Die Sitten werden roher, die Besucher anderen Besuchern, aber auch den Künstlern gegenüber respektloser. Hier setzte sich ein schlimmer Trend fort, den die Festspielleitung, wie auch immer, dringend bekämpfen müsste.
Die Bilanz zog Frank Piontek.
Produktionen der Festspiele werde auch berücksichtigt von:
Tops und Flops EXTRA: Nachlese zur Premierenwoche bei den Bayreuther Festspielen
