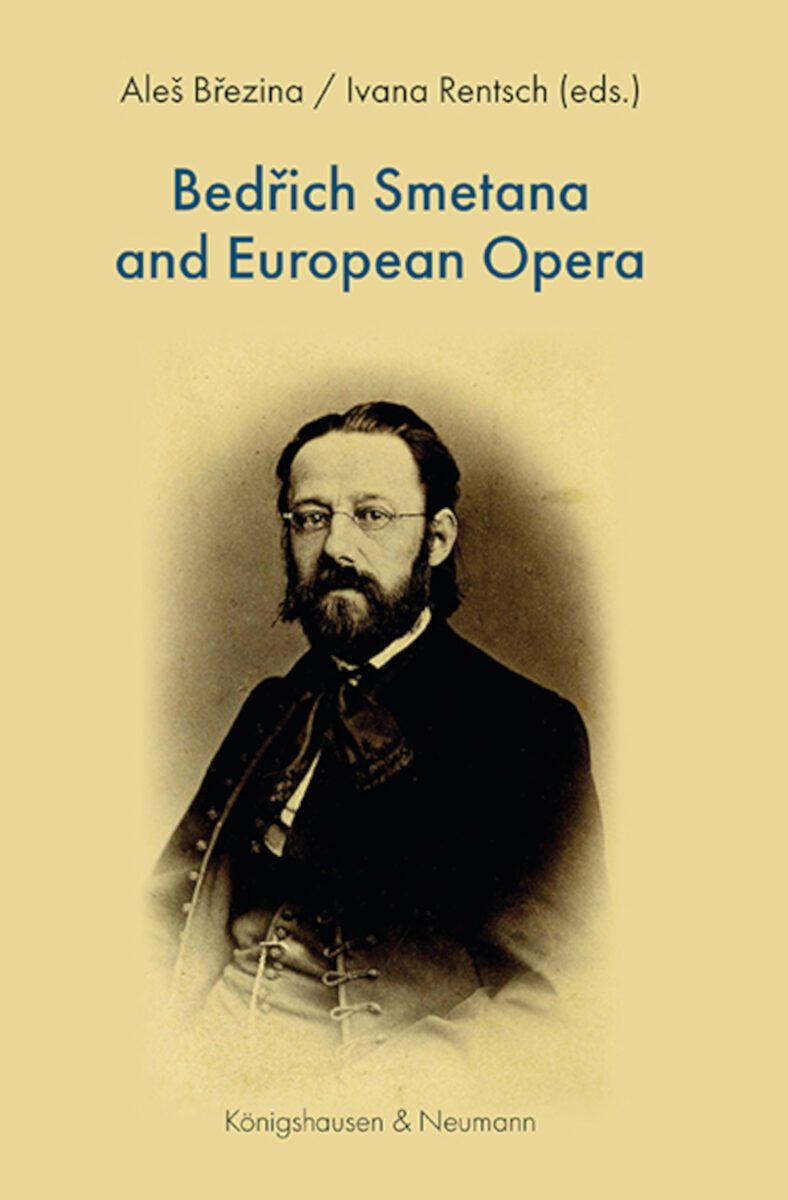
Die Menge der neueren Bücher über Smetana kann man an zwei Händen abzählen. Im deutschsprachigen Bereich fallen dem engagierten Smetanarianer Kurt Honolkas alte Rowohlt-Monographie, der Dokumentenband Smetana in Briefen und Erinnerungen (von 1954), natürlich auch Jungheinrichs wichtiges Buch Bedřich Smetana und seine Zeit ein. In der DDR erschien die Smetana-Biographie von Hana Séquardtová, im Prager Smetana-Museum kann man für wenig Geld einen Museumskatalog und ein gutes Buch über den Komponisten erwerben, und 2007 veröffentlichte Linda Maria Koldau einen Band über den Zyklus Mein Vaterland. Im englischsprachigen Bereich sieht es ähnlich aus. Hier fällt ein Titel von 2017 ins Auge, der im neuesten Buch über den „Begründer der tschechischen Nationalmusik“, wie er gern bezeichnet wird, gelegentlich genannt wird: Myth, Music, and Propaganda von Kelly St. Pierre. Im (hier übersetzten) Klappentext dieses Werks kann man Folgendes lesen: „Dieses Buch zeigt den tschechischen Komponisten Bedřich Smetana als eine dynamische Figur, deren Mythologie immer wieder umgeschrieben wurde, um sich den wechselnden politischen Perspektiven anzupassen. Die Interpretationen des tschechischen Komponisten Bedřich Smetana und seiner Musik haben sich ebenso häufig geändert wie die politischen Kontexte, in denen sie entstanden sind. Kelly St. Pierre untersucht Smetana sowohl als nationalistischen Komponisten als auch als nationales Symbol und enthüllt das Vermächtnis des Komponisten als eine dynamische Figur, deren Mythologie immer wieder umgeschrieben wurde, um sie an wechselnde politische Perspektiven anzupassen.“
Cum grano salis könnte der Waschzettel zum Buch von 2017 auch auf die Neuerscheinung gemünzt werden, die anlässlich des Smetana-Jahres 2024 herauskam: ein Sammelband mit 13 Aufsätzen und einer inhaltsreichen Introduction, die es bereits zentral mit den Themen Politik, Nation und Mythenbildung zu tun hat. Die Herausgeber Ivana Rentsch und Aleš Březina, die, nebenbei, die Beiträge dramaturgisch schlichtweg vollkommen angeordnet haben, setzen also den „Europäer“ Smetana in Kontext mit der Geschichte der tschechischen Smetana-Geschichtsschreibung: ausgehend von der These, dass es erst der Musikpublizist Otokar Hostinský war, der das Bild von einem Komponisten erfand, der ganz für sein „Vaterland“ lebte und arbeitete.
Die Crux besteht nun darin, dass sie so richtig wie falsch ist – denn Smetana selbst hat sich, woran kaum zu zweifeln ist, nach seiner Rückkehr aus Schweden ausdrücklich als patriotischer Komponist im tschechischen Musikleben positioniert, was die Anbindung an internationale Strömungen zumal der Oper nicht ausschloss. Gleichzeitig musste der Komponist, im Kampf gegen ideologische Betonköpfe wie František Pivoda, um sein Renommee kämpfen; wie bei Wagner war der Weg zum Ruhm nur auf dem Holperpflaster der gegnerischen Kritik zu machen. Die nationalistische Attitüde, die die Herausgeber Hostinský attestieren, ist nun nicht allein ein im späten 19. Jahrhunderte völlig normaler Affekt, von dem kein Volk frei war. So betrachtet, erweist sich die Kritik an Hostinskýs Interpretation des Komponisten als Nationalkomponist nicht als Konstruktion, sondern als Deutung des Smetanaschen Werks aus dem Geist der Nationbildung; dass sie seit Smetanas Ankunft in Böhmen mit besonderer Schärfe diskutiert wurde (obwohl der Gegensatz zum „Germanischen“ immer wieder neu ausgelotet wurde), muss nicht betont werden. Dass das Nationaltheater, gegründet als betont politische Kunst-Organisation einer noch nicht gegründeten Nation, als „Tempel“ bezeichnet wurde, kann vielleicht nur dem aufstoßen, der nicht davon ausgeht, dass die Kunst immer etwas mehr als einen politischen, im heutigen Sprachgebrauch: „nationalistischen“ Zweck hat. Nebenbei: Mag Libuše, die tschechische Nationaloper, die nur an wenigen Tagen aufgeführt wird, auch als solche konzipiert worden sein: Würde man sie heute noch spielen, hätte nicht der Komponist in Ariadne auf Naxos Recht, wenn er das „Heilige“ der Musik betont, weil sie bisweilen schlichtweg vollkommen ist? In der politisch korrekten Sicht einer Geschichtswissenschaft, die dem Nichtbedingten per se zu misstrauen scheint, gerät, glaube ich, das Eigentliche der Kunst, auch das Eigentliche der Kunstproduktion Bedřich Smetanas außer Sicht, das von den Zeitgenossen auf den Punkt gebracht wurde. Ein Journalist des US-amerikanischen Tschechenblatts Slavie lobte 1897 nicht grundlos von die „außergewöhnliche Schönheit“ der Musik der Smetana-Opern. Dies gilt sogar dann, wenn man wie Vincenzina C. Ottomano den Einsatz der Verkauften Braut in den Jahren 1934 und 1935 als Propaganda-Aktionen einer tschechisch-italienischen Achse porträtiert.
Nein, man muss nicht von einem Rezeptions-„Problem“ sprechen, wenn es um Otakar Hostinskýs Blick auf Smetana geht. Dass ausnahmslos alle acht vollendeten Opern Bedřich Smetanas heute noch in Tschechien, leider kaum in Deutschland gespielt werden, sollte zu denken geben und den Blick auf das künstlerische Erbe des einzigen Musikers lenken, der es, von heute aus betrachtet, wie kein zweiter Opernkomponist der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit den Operngiganten Wagner und Verdi aufnehmen kann. Leider – aber es ist angesichts der Aufführungsgeschichte der Smetana-Opern im aussertschechischen Europa nachvollziehbar – werden in den 13 ausgezeichneten Beiträgen nur drei Opern in den Blick genommen: Libuše, Prodaná nevěsta und Dvě vdory, bevor Čertova stěna in einer Art Appendix wenigstens gestreift wird. Während die Oper über die mythische tschechische Urherrscherin auf ihr tschechisches Wirkungsgebiet beschränkt blieb und bleibt, haben sich die Zwei Witwen (https://deropernfreund.de/theater-pilsen/pilsen-zwei-witwen-bedrich-smetana/) wenigsten ein wenig das europäische Terrain erobert. Alle anderen Smetana-Opern blieben seltene Gäste auf den deutschen und englischen Bühnen. Nur die Verkaufte Braut bürgt für den Ruhm des Opernkomponisten in Deutschland – eines von acht Werken, die denkbar unterschiedlich angelegt wurden. Europa aber wird im Buch nicht allein als Ort der Smetana-Opern charakterisiert, sondern als musikalischer Bezugspunkt von Smetanas Interessen.
„Smetana’s Opera Aesthetics“, „Smetana’s Reception of European Opera“ und „Early Reception of Smetana’s Operas“: so lauten die drei Teile des exzellent kompilierten Bands. Martin Nedbal widmet sich den drei Großgestirnen Gluck, Mozart und Beethoven, die am Prager Interimstheater, also dem Prozatímní divadlo, dem „Provisorischen Theater“, oft gespielt wurden: in Fassungen, die man nur als korrumpierend bezeichnen kann, was schon dem sensiblen und unbestechlichen Kritiker Smetana auffiel. Nedbal spricht jedoch in Zusammenhang mit Le nozze di Figaro von einer „nationalen“ Werktreue, da die Zeitgenossen die den Figaro als ihre „geliebte“ Oper würdigten. Schleicht sich da nicht wieder ein durchaus nicht geheimer Vorbehalt gegen das Ansinnen ein, eine im übrigen geniale Oper als ideelles (!) nationales Eigentum zu betrachten? Vergleichsweise positivistisch und gewohnt präzis verfährt dagegen Arne Stollberg, wenn er am Vorspiel der Libuše die tableauhafte Dramaturgie des Werks genau herausarbeitet, nachdem er die Diskussion der Ouvertüren-Form konzis zusammengefasst hat. Typisch für Stollbergs monographische Argumentation der zur Symphonischen Dichtung tendierenden Einleitung zur Oper ist schon die Beobachtung, dass er kleinste Verschiebungen der Harmonik (im abrupt zu C-Dur changierenden Schluss des Vorspiels) in ihrer Ambivalenz zu würdigen weiß. Die „Festliche Oper“ gerät in den Blick, wenn bei Ivana Rentsch die politisch inszenierten Bilder des Werks mit zeitgenössischen Ansichten herausragender politischer Ereignisse wie der 1867er ungarischen Krönungsfeier Franz Josephs mit den Rezeptionsdokumenten einer westdeutsch-österreichischen Nachkriegszeit zusammengebracht werden; Sissi, die junge Kaiserin, hat hier ihren legitimen Auftritt. Auftritte waren auch die seinerzeit beliebten Lebenden Bilder oder Tableaux vivants (die aktuelle Prager Inszenierung der Libuše –,(https://deropernfreund.de/nationaltheater-prag/prag-libuse-bedrich-smetana/) beginnt und endet mit einem solchen Lebenden Bild, das, aber das liegt im Auge des Betrachters, durchaus nicht lächerlich wirkt): für das historische Gedächtnis der k.k.-Monarchie wie im Prag Bedřich Smetanas. Thomas Jaermann untersucht in seinem interessanten Beitrag, der sich um einige „Nebenwerke“ dreht, die Musik zu zwei Puppenspielen und zwei Lebenden Bildern. Klar wird, entgegen der gebräuchlichen Terminologie, dass die Musik zu Doktor Faust und Oldřich a Božena nicht als „Ouvertüren“, sondern als Schauspielmusik bezeichnet werden müssen. Interessant auch der Bezug zu Dalibor und Čertova stěna: hier wie dort begegnen in verschiedenem Maß Lebende Bilder. Brian S. Locke erläutert zuletzt im ersten Teil, wieso Smetana darauf verzichtet hat, Eliška Krásnohorskás genau beschriebenes, auch in Bezug auf die Musikdramaturgie charakterisiertes Libretto Vlasta nicht zu vertonen.
Im zweiten Großteil des Bandes geraten die internationalen Opern in das Blickfeld, die der Patriot Smetana in vollem Bewusstsein für die Güte der deutschen und französischen Opern in seiner Zeit als Kritiker rezensiert und als Kapellmeister am Interimstheater dirigiert hat. Klar wird, das die italienische Oper als Bindemittel zwischen den Nationen aufgefasst wurde. Dass Wien eine Hauptstadt der italienischen Oper und Staatskanzler Metternich ein regelrechter Opernfan war, passt ins Bild, das gegen den Nationalismus die Übernationalität der Gemeinde der Opernliebhaber setzt. Olga Mojžíšová gibt einen Überblick über Smetanas, auch Wagner beinhaltende Opernrezeption, wie sie sich in seinen leider kaum ins Deutsche übersetzten Besprechungen und Tagebüchern spiegelt, auch über seine Anmerkungen zu seinen eigenen Opern – ein Aspekt, der von Sandra Bergmannová vertieft wird, die sich die Zeitungsartikel von 1858 bis 1865 vorgenommen hat. Erstaunlich bleibt, dass Smetana in einer „normalen“ Gazette für ein musikalisch gebildetes Fachpublikum schrieb; spannend ist der Einblick in die Prager Opernpraxis vor und nach Smetanas Eintritt in das Provisorische Theater, in dem man im Sommer mehr schwitzte als heute im Bayreuther Festspielhaus – und gelegentlich zweisprachig sang (was mich an eine Aufführung der Prodaná nevěsta im damaligen Smetana-Theater erinnert, als 1978 die Mařenka von einer slowakisch singenden Interpretin gespielt wurde). Milan Pospíšil widmet sich anschließend en detail den Briefen Smetanas, in denen Genaueres über seine bühnenpraktische und ästhetische Auffassung seiner Opern zu lesen ist, auch über seine Kompromisslosigkeit in Sachen Änderungen; allein bei der Prodaná nevěsta erlaubte er Modifikationen, was Rückschlüsse auf seine skeptische Haltung gegenüber seinem international erfolgreichsten Stück zulässt. Problematisch erscheint hier nur die These, dass die Opern aufgrund ihres (diskutablen) tschechischen Nationalcharakters im Ausland kaum Erfolge feiern konnten. Man könnte durchaus auf die ketzerische Idee kommen, dass Smetanas Opern – Polkarhythmen hin oder her – keinen wie auch immer gearteten „nationalen“ Stil, sondern allein den Smetana-Stil aufweisen, auf den der Komponist zurecht stolz war… Und gesetzt den Fall, das „Nationale“ dieses Stils sei ein Hinderungsgrund für die langfristige nichttschechische Popularität des Tajemstvi (https://deropernfreund.de/theater-pilsen/pilsen-das-geheimnis-bedrich-smetana/), des Hubička (https://deropernfreund.de/theater-pilsen/pilsen-der-kuss-bedrich-smetana/) oder der Čertova stěna, ganz zu schweigen von den bei uns so gut wie nie aufgetretenen Brandenburgern in Böhmen (https://deropernfreund.de/theater-pilsen/pilsen-die-brandenburger-in-boehmen-bedrich-smetana/) gewesen: Wieso nur gilt ausgerechnet die im Böhmischen spielende und mit tschechischen Rhythmen angereicherte Verkaufte Braut heute als erste große tschechische Oper, während Zwei Witwen (zugegeben: unter Einschluss einiger köstlicher Dorf-Szenen) als Zeugnis einer sog. Salon-Oper nicht die gleiche „Volkstümlichkeit“ errang wie Prodaná nevěsta?
Von hier ist der Weg zum Dritten Teil nicht weit. David Brodbeck rekonstruiert, ausgehend von deutschen Versuchen, die Smetana-Oper über den Ozean zu bringen, die US-amerikanische Aufführungsgeschichte eben der Bartered Bride, um den Zusammenhang mit der tschechischen community in den Vereinigten Staaten, denen die Oper das nationale Bindeglied zur alten Heimat war – so wie die Wiener Aufführungen des Werks durchaus politisch konnotiert war. V.C. Ottomano erläutert in ihrer genauen Studie den Wandel des Geschmacks, aber auch der politischen Kontexte zwischen 1905 und 1935, die die Prodaná nevěsta schließlich in der italienischen Sicht zu einer guten Oper und zu einem Objekt der „kulturellen Diplomatie“ der Zwischenkriegszeit machten. Es fällt auf, dass die frühen italienischen Kritiker durchaus das Richtige trafen, als sie der Oper jenen Humor absprachen, der noch lange nach dem zweiten Weltkrieg als typisch für das Werk galt. Die Italiener hatten da, ohne dem Werk allzu viel Liebe entgegenzubringen, schärfer gesehen als die Smetana-Freunde, die die Tiefen des Stücks souverän übersahen. Der Smetana-Aficionado ist schon für solche publizistischen Funde dankbar. Christopher Campo-Brown folgt mit einem Aufsatz zur frühen tschechischen Aufführungsfassung der Zwei Witwen, die Václav Juda Novotný aufgrund des „schlechten Librettos“ zu verbessern trachtete, indem er die Musiknummern umstellte und die Rezitative kürzte. Herauskam eine Oper im modischen Bauernstil, die 1923 ihre letzte Aufführung erlebte. Hier sprach die (zweifelhafte) Praxis eindeutig gegen eine „Sacralization“ des Autors, die von Hostinský verteidigt wurde, indem er auf den genauen Tonartenplan und die organische Anlage der Oper hinwies. Es stimmt: Smetana hatte zweifellos einen untäuschbaren Sinn für die „musikalische Architektur“ einer Oper (und das Libretto Emanuel Züngels wird heute durchaus nicht mehr durchgängig als zweitklassig abqualifiziert). Interessanterweise gibt Campo-Brown Hostinský Recht, also dem Schriftsteller, der Smetana, so die These, zu einem nationalen Heiligtum erklärt hatte.
Wie gesagt: Die Tatsache, dass ausnahmslos alle acht Opern des Meisters heute noch gespielt werden, sollte zu denken geben. Ist er für das tschechische Publikum, auf das die Reputation Smetanas letzten Endes ankommt, nicht doch ein „impeachable genius“?
Man sollte schon misstrauisch sein, wenn von „figures like Smetana“ die Rede ist – denn wer ist schon „wie Smetana“? Den Rausschmeißer aber macht Michael Beckerman, ein US-amerikanischer Autor, der seit vielen Jahren enge Verbindungen zu Tschechien und den Tschechen hat. In seinem Aufsatz „The devils of Litomyšl“ spielen die Teufel der böhmischen Marionettentheater und der Volkssagen, aber auch der modernen Kunst eine gewichtige Rolle, so auch der Rarach in der Teufelswand (https://deropernfreund.de/theater-pilsen/pilsen-die-teufelswand-smetana/). Ob man angesichts des kompositorisch ausgesprochen modernen Teufelswalzers, der schon wie Mahler klingt, von einem ausgeprägten „Czech style“ reden kann, sei dahingestellt. Schön aber ist der letzte Absatz, der den Titel des im besten Sinne anregenden und materialreichen Sammelbands über den großen Komponisten Bedřich Smetana hervorragend zusammenfasst:
„No matter what, Smetana was able to create one of the world’s greatest devils in Rarach, and provide him with a special dance that, like so much of Smetana’s best work, brings together the center and periphery, the local and the universal, and in doing so achieves a transcendent stature.“
Man kann es nicht besser ausdrücken.
Frank Piontek 18. Februar 2025
Bedřich Smetana and European Opera
Hrg. von Ivana Rentsch und Aleš Březina.
Königshausen und Neumann, 2024.
298 Seiten. 49,80 Euro.
