Wenn man, wie der Verfasser dieser Zeilen, seine erste und also auch seine prägende Opernzeit in der Deutschen Oper Berlin zugebracht hat, nimmt man den voluminösen Doppelband, den der Jung-Wissenschaftler Matthias Rädel als Dissertation vorgelegt hat, natürlich mit besonderem Interesse in die Hand. Er trägt einen eher sperrigen Titel: Selbstverständnis und Identität des Opernhauses in Berlin-Charlottenburg. Liest man sich das Ganze durch, kommt man schon schnell dahinter, dass er den Inhalt nicht ganz fasst, oder anders: dass er weit darüber hinausgeht. Denn Rädel hat mit den insgesamt 1587 Seiten nicht allein eine Arbeit veröffentlicht, in der das Kernthema analysiert wird. Er hat, alles in allem, eine politisch-sozial-gesellschaftlich-künstlerische Geschichte des einstigen Deutschen Opernhauses, der Städtischen Oper und der heutigen, nach dem Zweiten Weltkrieg benannten Deutschen Oper vorgelegt: von 1907 bis 2004.
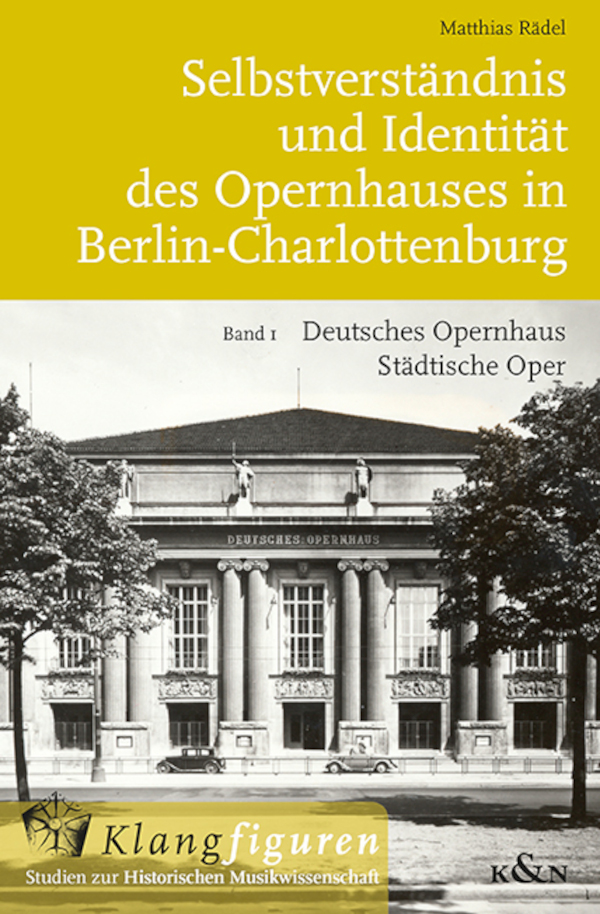
Sie wäre, um gleich zu Beginn zu beckmessern, ein wenig – na, sagen wir: um mindestens 150 bis 200 Seiten – schmaler, doch nicht dünner ausgefallen, hätte sich ein Korrektor oder Lektor oder sonst ein Leser vor der Drucklegung die Mühe gemacht, die überflüssigsten Wiederholungen zu tilgen. So aber haben wir schon schnell das Vergnügen, nicht allein auf kurzen und etwas längeren Strecken das zu bemerken, was man im Akademikerdeutsch als „Redundanzen“ zu bezeichnen pflegt. Wenn zwischen dem Fließtext und einer auf der selben Seite befindlichen Fußnote gleiche Sätze und ähnliche Formulierungen auftauchen, darf man gern daran zweifeln, ob auch nur ein Mensch einschließlich des Autors die gesamten 1500 Textseiten komplett und am Stück gelesen hat. So aber hat der Leser irgendwann den Eindruck, dass ihm der Autor ein wenig die wertvolle Lesezeit geraubt hat, die er gern für andere Publikationen geopfert hätte.
Was für die Arbeit einnimmt, ist eine inhaltliche Tiefe wie Breite, die ganz aus den Quellen geschöpft wurde, diese auch kritisch unter die Lupe nahm. Grundthese ist die begründete Annahme, dass das Haus in der Bismarckstraße, dessen Gründung ebenso genau beschrieben – nicht skizziert – wird wie die Geschichte der nächsten gut 100 Jahre, niemals frei war von gesellschaftlichen und politischen Interessen, die so etwas wie eine Identität formen sollten. Im Grunde ging und geht es bei einem Theater immer um ein „Image“, das sich in der Zeit beweist oder vom Publikum, der Presse oder/und den politischen playern konterkariert wird. Liest man die Monumentalstudie am Stück, erhält man den Einblick in eine scheinbar immerwährende Zeit der Krisen; Operndirektoren werden, falls sie Zeit haben, das Werk zu studieren, mehr als einmal bitter schmunzeln. Um Opernkunst zu machen, bedarf es ökonomischer Mittel; Rädel beschreibt in aller Ausführlichkeit, dass es immer wieder an denselben haperte – und die Geschichte trotzdem immer weiterging. Er erläutert die Abhängigkeit des Charlottenburger Opernhauses von der Stadt Charlottenburg, seine Intention – die von den einzelnen Intendanten abhing – und seine Spielplanausrichtung; das Haus sollte lange Zeit ein explizit nicht bildungsbürgerliches Publikum ansprechen. Manche Diskussionen wirken daher so, als wären sie von heute: wenn hier die schlechte Akustik moniert und dort das skandalös schlechte Publikumsverhalten gezeichnet wird (der Autor erinnert sich noch an die Proteste, die der Pöbel, der immer gegen Götz Friedrich war, während der Walküre-Premiere über die Sänger und Musiker ausschüttete), wenn die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Berliner Opernhäusern dargestellt und die „Opernkrise“ schon vor einem Jahrhundert als Publikumskrise ausgemacht wurde. Dabei geraten die wichtigsten Protagonisten der Berliner Operngeschichte in den Blick. Selten wurde über Heinz Tietjen so genau und differenziert geschrieben wie in diesem Werk. Wer wissen will, welches Profil der Regisseur und Intendant Carl Ebert besaß, muss zu Rädels Buch greifen. Wer ermessen möchte, dass die Theorie eines täglichen Fest-Theaters, das nicht erst vom 1980 frischgebackenen Intendanten Götz Friedrich verkündet wurde, mit der Praxis eines täglich störanfälligen Opernbetriebs kollidierte, erhält mit dem neuen Buch eine Jahrhundertschau in die Hände, die manchen Opernhaus-, Intendanten- und Regisseur-Kritiker nachdenklich machen müsste.
Es waren nicht zuletzt, neben den permanenten finanziellen Diskussionen, die Empfindlichkeiten und Eigeninteressen der Dirigenten und Intendanten, der GMDs und Kapellmeister, die die dauernde Krise befeuerten. Fritz Busch, Bruno Walter, Fritz Stiedry, Giuseppe Sinopoli, Lorin Maazel: Das sind nur die wichtigsten Namen in der Riege der bekannten Pultdompteure. Neben den Geschichten, die die Opern-Geschichte erst formten (man liest immer noch mit süßem Schauder die Jugendgeschichte der skrupellosen und unkollegialen NS-Profiteurin Elisabeth Schwarzkopf), sind es die strukturellen Daten, die aus Rädels Werk ein profundes Nachschlagewerk machen. Immer wieder werden freilich teuflisch klein gesetzte Statistiken und Listen in den Text eingerückt. Wir erfahren viel über bekannte, fast mehr noch über unbekannte Werke (etwa von Leo Spies) und Uraufführungen, über die die Zeit fast völlig hinweggegangen ist. Nicht erst während der NS-Zeit kamen relativ wenige neue Opern und Ballette im Deutschen Opernhaus heraus – schon vor den 1. Weltkrieg befand sich das Haus gegenüber der Oper unter den Linden in der künstlerischen Defensive, wenn es sich auch künstlerisch bewusst anders positionierte, bevor die Moderne nach dem 2. Weltkrieg wieder Einzug hielt. Wie gesagt: Krise war immer – und schon in den 20er Jahren befand sich das Opernhaus unter dem ideologischen Beschuss der Nazis, die aus ihm, nach den bisweilen avantgardistischen Produktionen unter Carl Ebert, eine Volksoper machen wollten; schon zuvor hatte es übrigens extrem judenfeindliche Störaktionen am Haus gegeben. Die Erzählung der 20er und 30ere Jahre und der Kriegsjahre gehört zu den spannendsten Teilen des Bandes. Hier ist es der singende Intendant Wilhelm Rode, eine eigenwillige Persönlichkeit, die während der NS-Jahre eine ambivalente Position zwischen den Fronten einnahm. Dass die (bekanntlich widersprüchliche) NS-Kulturpolitik breit erläutert wird, da das Opernhaus von Goebbels Gnaden zum Instrument einer nationalistischen Propaganda gemacht wurde, versteht sich von selbst. Was hier der Untersuchung allerdings fehlt – es ist eine empfindliche Leerstelle – ist die Rekonstruktion des Zuschauerverhaltens und der Meinungen während der Jahre 1933 bis 1944. Gab es hier wirklich keine Quellen, die lesbar gewesen wären? Ob sich die Idee einer national durchtränkten Volksoper wirklich im Publikum niederschlug, wird m.E. nicht aus dem Repertoire ersichtlich, auch wenn die Deutschen und die auch politisch alliierten Italiener hier führend waren. Zugegeben: Es gab ein Kritikverbot; die kritischen Quellen fließen in der NS-Zeit längst nicht so sprudelnd wie zuvor. Klar wird allerdings, dass das Deutsche Opernhaus politischere Intentionen gepflegt hat als die Staatsoper, was dort sicher auch an der Position Heinz Tietjens lag.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man, bedingt durch den Mauerbau, in Charlottenburg eine neue Identität ausbilden müssen, die die Teilung der Stadt als politische Folie integrierte. Der zweite, wesentlich umfangreichere Band erzählt die Geschichte(n) des Hauses weiter, nun mit den alten Protagonisten Carl Ebert und Heinz Tietjen, aber auch mit Wieland Wagner, der tatsächlich eine Intendanz anstrebte, mit Sellner, Sehfehlner, Palm und Friedrich, mit Karajan, Hollreiser, Fricsay, Cobos und all den anderen Dirigenten, die das Bild des Hauses nach außen trugen und, wie im Falle Friedrich-Sinopoli, für einen kommunikativen Super-GAU sorgten. Liest man von den Problemen, die man nach 1961 mit einem Publikum hatte, das nur die Sänger, nie die Regiearbeiten gelten ließ, versteht man auch, wieso jene Produktionen, die heute als „legendär“ und kanonisch gelten (wie Friedrichs Ring und Neuenfels’ Macht des Schicksals), damals so übel beschimpft worden sind. Nein, Matthias Rädel hat keine gloriose Geschichte des West-Berliner Opernhauses vorgelegt – aber er hat mit seiner herkulischen Forschungsarbeit Archive und Stränge erschlossen, die man so detailliert und in die allgemeine, stets (einschließlich Schah-Besuch und Opernball) zwischen Links und Rechts changierende Kultur- und Zeitgeschichte eingebunden, noch nicht gekannt hat. Und der „einfache“ Zuschauer der Jahre 1975 bis 1988, der zwar schon damals Zeitungen las und neben den Aufführungen diverse Matinéen und Podiumsdiskussionen besuchte, kapiert plötzlich, wieso dies und jenes hinter oder zwischen den Kulissen so und nicht anders ablief.
Da nimmt man doch gern einige Wiederholungen in Kauf.
Frank Piontek, 30. Oktober 2025
Matthias Rädel:
Selbstverständnis und Identität des Opernhauses in Berlin-Charlottenburg
2 Bände, 1587 Seiten
Königshausen & Neumann
