„Das Thema Wagner und Tanz ist bisher nur wenig ins allgemeine Bewusstsein gedrungen.“ Alfred Stenger (Musikwissenschaftler, Hochschullehrer und Autor mehrerer beachtlicher Bücher) hat recht. In der Regel hat der Komponist direkte oder formal geschlossene Tanzformen gemieden: Seine Tanz-Ästhetik entfaltet das Angedeutete mehr als das Unmittelbare, das Latente mehr als das Offene. Auch in einer neuen Ausgabe des im wagneraffinen Verlag Königshausen & Neumann erschienenen „Wagnerspectrums“ mit dem Schwerpunkt „Wagner und der Tanz“ vertritt Stenger seine These. In seinem eigenen Buch zum Thema liest man „Wohl selten gibt es Gespräche über Richard Wagner, in denen der Tanz zur Sprache kommt.“
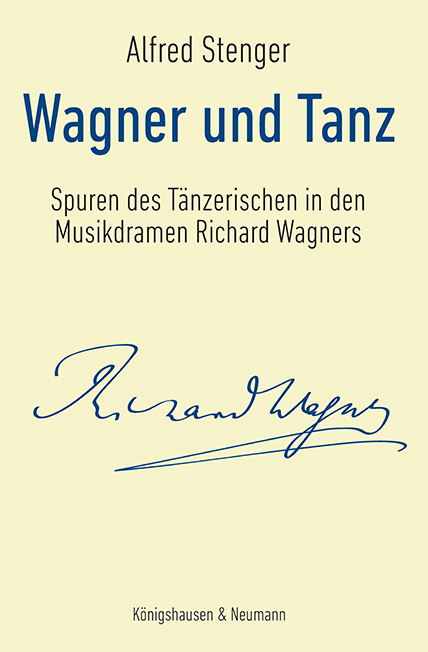
Oft sind Wagners Tanzformen nur sehr subtil, im Verborgenen und Beiläufigen sozusagen, angelegt. Sie wollen gesucht werden. Alfred Stenger begibt sich in seinem kleinen, aber sehr konzisen Buch auf Spurensuch, akribisch und wissenschaftlich korrekt wird er erstaunlich fündig.
Stenger geht aus von den Opern unterschiedlichster Epochen und deren spezifischer Verwendung des Tänzerischen: Er untersucht und vergleicht Mozart, Rossini, Verdi, Puccini, Leoncavallo, Offenbach, Tschaikowsky, Smetana, Mussorgsky, Richard Strauss und Debussy und kommt zu dem Schluss: Die Opern genannter Komponisten „lassen trotz ihrer Unterschiede eine Gemeinsamkeit erkennen: Sie sind stilistisch abgerundet. Für Wagner jedoch bilden derartige Tanzformen eher Ausnahmen. Erwähnt seien der Tanz der Lehrbuben (Meistersinger), Siegfrieds Rheinfahrt (Götterdämmerung) sowie der Karfreitagszauber (Parsifal). Die Venusbergmusik (Tannhäuser) wirkt formal geschlossen und offen zugleich. Darüberhinausgehend ist das Ballett aus Rienzi als Folge klar definierter Tanz-Stimmungen anzusehen.“
Stenger unterscheidet sehr differenziert Tanzszenen, eindeutige Tänze, rhythmisch federnde Verläufe, Tanzstrukturen, Tanzgesten, Tanzstimmungen, Tanz als archaische Expression, Tanzgesten, Andeutungen von Tänzen (Walzer, Marsch, Fanfare, Menuett, Polonaise, Gavotte, Sarabande), tänzerische Fragezeichen, Tanzrelikte, Tanzimpressionen und Tanzspuren etc.
In den Musikdramen Wagners ist das Tänzerische vorwiegend in größere Zusammenhänge eingebunden, so wird man belehrt. Oft offenbart es sich nur in wenigen Takten. Stilistische Vielfalt und Mehrdeutigkeit bilden einen faszinierenden musikästhetischen Radius.
Stenger entdeckt mehr oder weniger offensichtliche, eindeutige oder versteckte Spuren des Tänzerischen in jedem der dreizehn Bühnenwerke Wagners (Die Feen, Das Liebesverbot, Rienzi, Der fliegende Holländer, Tannhäuser, Lohengrin, Tristan und Isolde, Die Meistersinger von Nürnberg, Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried, Götterdämmerung und Parsifal). Sie sind individuell gestaltet, beleben dramaturgische Prozesse und verfeinern Charaktere der agierenden Personen. Dem musikästhetischen Unternehmen des Buches gelingt es, eine umgreifende und innovative Spurensuche des Tänzerischen darzulegen, deren Vielfalt gleichermaßen überrascht und fasziniert.
Stenger analysiert die Werke akkurat und präzise, in streng musikwissenschaftlichem Jargon. Um ein Beispiel aus Tristan und Isolde zu geben:
Die beiden ersten Takte der 1. Szene „exponieren den Gestus einer Sarabande, der in der zweiten Phrase leicht variiert wird. Indes wirkt der nächste Abschnitt wie ein langsamer Walzer. Das Semplice der B-Dur-Melodie ,,Wehe, wehe, du Wind!“ erfährt unmittelbar danach eine Verfärbung: ,,Wehe, ach wehe, mein Kind“. Der Schluss des Liedes, die letzten drei Takte, enthalten Splitter eines Marsches. Die Celli nehmen das Lied des Seemanns zehn Takte später auf, um es zu einem längeren Spannungsbogen auszudehnen. Häufige Staccati verändern nicht nur die Artikulation, sondern auch die Atmosphäre. Rhythmische Elemente treten plastisch und resolut hervor. Indes entfaltet sich die melodische Linie im Part der Brangäne: ,,Blaue Streifen stiegen im Westen auf …“. Hier schwingt ein stiller Walzerduktus, der sich in der häufigen Kombination von einer Halben und einer Viertel (oder zwei Achteln) zeigt. Zu Beginn der 2. Szene wird das Seemannslied von einem tremolierenden Orgelpunkt der Celli und Bässe begleitet (mäßig langsam). Klangnebel entstehen. Sie verwandeln die sinnliche Unmittelbarkeit des Liedes in einen gespenstischen Traum und bereiten den nächsten Einsatz der Isolde vor ,,Mir erkoren, mir verloren …“. Filigrane Linien formieren sich zur schwebend-tänzerischen Impression und geben der melancholischen Korrespondenz zwischen Singstimme und Englischhorn Raum. Diese atmosphärische Veränderung ist an einem Detail ablesbar: Das Lied des Seemanns ist nicht vollständig. Es endet mit dem Ton fis, einem Ton, der den melodischen Anstieg der Isolde unmittelbar einleitet. Gedehnte Walzergesten werden zur Andeutung irrealer Gefühle, auch zur emotionalen Verschlossenheit. Das Tänzerische kommt auf Umwegen, gleichsam schleichend daher. Viertel-Vorhalte verleihen den Senkungen des Textes einen stillen Ausdruck und bestätigen die Melancholie des ‚Walzers‘. Die zweite Isolden-Phrase ,,Todgeweihtes Haupt! Todgeweihtes Herzl“ verbindet akkordische Dichte mit rhythmischer Strenge. Kontrastierend zur vorigen ,Impression‘ werden hier subtile Spuren eines Trauer—Tanzes fühlbar.“
Das ist frappierend, ja erhellend in seiner Sachlichkeit, aber – mit Verlaub gesagt – dröge zu lesen, wohl nur für Fachleute ein wirkliches Vergnügen. Aber immerhin: Das Buch schließt eine Lücke. Über das Tänzerische bei Wagner wurde noch nie so dezidiert – man könnte auch sagen so sophisticated – nachgedacht.
Die stilistische Fülle der aufgezeigten Details deutet auf eine entscheidende Grundstruktur von Wagners Ästhetik: Primär geht das Tänzerische mit subtilen kompositorischen Prozessen einher. Selbst dort, wo sein Klang nicht zu vermuten wäre, wie beispielsweise in Tristan und Isolde oder in Parsifal, zeigt es sich in seinen farbenreichen und sensiblen Schattierungen. Aufs Ganze gesehen entfaltet sich in Wagners Tanz-Ästhetik das Angedeutete mehr als das Unmittelbare, das Latente stärker als das Offene. So erklärt sich auch der Untertitel der vorliegenden Untersuchung: „Spuren des Tänzerischen in den Musikdramen Richard Wagners“.
Dieter David Scholz, 13. Oktober 2025
Alfred Stenger: Wagner und Tanz
Spuren des Tänzerischen in den Musikdramen Richard Wagners
Königshausen & Neumann 2025. 143 S.
