Der Freischütz und kein Ende, möchte man, ein bekanntes Zitat paraphrasierend, ausrufen. Der Freischütz gehört nicht gerade zu den Opernobjekten, die in den letzten Jahren unbeachtet geblieben sind – wenn auch die gegenwärtigen Aufführungsziffern von Webers Meisterwerk nicht mehr mit denen der 50er und 60er Jahre konkurrieren können. Doch hat sich die Wissenschaft, nicht zuletzt im Umkreis der 200. Wiederkehr des Jahrestags der Uraufführung am Berliner Schauspielhaus, intensiv um die dramaturgisch-musikalischen Fragen gekümmert, wovon auch die zwei letzten Rezensionen beim Opernfreund (Buchkritik „200 Jahre Freischütz“ , Buchkritik „Carl Maria von weber als Wegbereiter Wagners“) zeugen. Gaspare Spontinis Olympia, die gleichfalls als Meisterwerk bezeichnet werden muss, ist dagegen dem so genannten normalen Opernfreund ein unbekanntes Werk geblieben, ja: Opernaficionados dürften eher Die Vestalin als Olympia kennen, weil Maria Callas einst die Vestapriesterin war und jüngere Aufführungen zumindest das Überleben des Werks auf den Opernbühnen randständig gesichert haben.
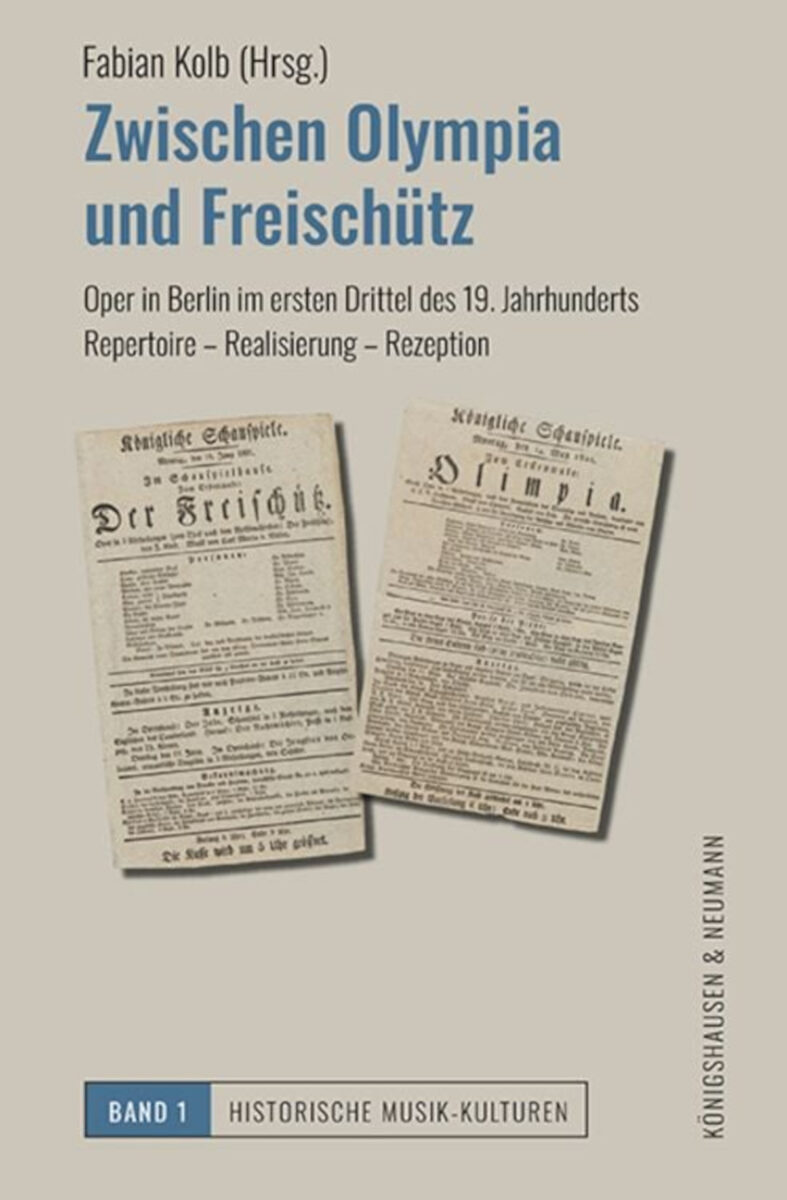
Allein das „Zwischen“ macht die Musik. Der neue Band, Frucht eines Berliner Symposions, das ursprünglich anlässlich der 200jährigen Feier der Wiederkehr der zufälligerweise innerhalb von fünf Wochen erfolgenden Berliner Premieren der beiden Werke in unmittelbarer Nähe der Uraufführungshäuser stattfinden sollte, aber aus den bekannten Gründen aufs darauf folgende Jahr 2022 verschoben wurde – der neue Band dreht sich zwar sowohl um das „bekannte“ wie das eher unbekannte Großwerk, hat es jedoch laut Untertitel mit der Oper in Berlin im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts zu tun. Man pflegt die Jahre zwischen 1810 und 1830 auch als „Berliner Klassik“ zu bezeichnen, in deren Urgrund die fast gleichzeitige Ausdertaufehebung sowohl der „romantischen“ Oper wie der ins Deutsche gebrachten Tragédie-lyrique nach einer Vorlage von Voltaire möglich war, bevor ein unseliger, auf nationalistischen Stereotypen basierender Kulturkampf gegen den italienischen Komponisten, der in Paris Karriere gemacht hatte und sodann zum königlich-preußischen GMD ernannt worden war, jeden Gedanken an eine Synthese unmöglich machte. Die spreeländische Zerstörungsgeschichte Spontinis ist bekannt; erst vor wenigen Jahren hat Anne Henrike Wasmuth, nachdem Norbert Miller im zweiten Teil des vor Allem von ihm verfassten, wunderbaren Monumentalwerks Europäische Romantik in der Musik das Genie exemplarisch gewürdigt hatte, in Musikgeschichte schreiben den Krieg gegen Spontini gründlich kontextualisiert und analysiert, auch erschienen in den letzten Jahren immer wieder wertvolle Bücher und Aufsätze über Spontini, seinen napoleonisch geprägten Klassizismus, seinen besonderen Stil und seine auch musikalische Wirkung, insbesondere auf einen gewissen Richard Wagner, ja: Ein Sammelband zur Berliner Hofkapelle und zur Hofoper Berlin im „langen 19. Jahrhundert“ trug gerechterweise den Namen des Musikers schon im Titel: „Von Spontini bis Strauss„. Fabian Kolb, Mitherausgeber des neuen Bandes, trug 2018 einen ausführlichen Beitrag zu Spontini und dessen Zerriebenwerden im Berliner Kompetenzgerangel bei. Doch ist die Forschung, zumal die Spontini-Forschung, noch längst nicht an ihr Ende gekommen. Im neuen Tagungsband stehen Olympia (2mal), Die Vestalin (2,2mal) und Fernand Cortez (1mal) im Mittelpunkt einiger der 17 Aufsätze, während Weber einmal mit dem Freischütz und zweimal mit Euryanthe vertreten ist. Also Punktsieg für Spontini, oder anders: jene Werke, die nicht im Bewusstsein einer opernliebenden Öffentlichkeit verankert sind und seinerzeit neben dem Freischütz einen Berliner Sonderweg der Dramaturgie und Spielplangestaltung verbürgten, werden zurecht herausgestellt.
Stichwort Kontextualisierung: Michael Walter, der sich wie kaum ein zweiter Forscher in der Institutionengeschichte der Oper auskennt, beschreibt zunächst die Häuser, also das Berliner Hoftheater, die Hofoper und das Königstädter Theater, um die theaterkulturelle und durchaus rechtsunsichere Topographie zu erläutern, in der die Gleichzeitigkeit von „deutschem“ und „welschem“ Werk nicht paradox, sondern zunächst einmal fast logisch erschien. Darauf verweist im Übrigen auch die Tatsache, dass Weber nicht Spontinis Gegner war und eine populäre Bearbeitung von Themen aus den Opern beider Komponisten innerhalb eines Stücks das Publikum erfreuten, während sich eine radikal intolerante und im Grunde schier unmusikalische Musik-„Kritik“ darauf einschwor, das Publikum gegen den „Fremden“ aufzuhetzen – während der königliche Hof, insbesondere Friedrich Wilhelm III., gerade Die Vestalin sehr schätzte und der Spontini-Verehrer (und gute Komponist) E.T.A. Hoffmann, der Schöpfer zweier bedeutender romantischer Opern (Undine und Aurora), eine deutsche Textfassung der Olympia erstellte. Walter kann klar machen, dass die Aufführung einer deutschen Oper (wie Der Freischütz) zunächst nicht mit nationalistischen Vorstellungen verbunden war, bevor der Heißmacher Ludwig Rellstab (darauf verweist Sabine Henze-Döhring) einen Ton in die Publizistik brachte, der Weber zu Unrecht gegen Spontini ausspielte. Dass es 1821 nur drei neue Opern in der Hofoper und im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt gab, auch dies sollte zu denken geben. Spannend wird es, wenn Walter die angekündigte Pleite des Königstädter Theaters beschreibt – und fast gegenwärtig, wenn Jasmin Seib den Kampf der drei Häuser um ein Repertoire zum Besten gibt, in dem es nicht zuletzt um die Kasse ging.
Um ästhetisch-stilistische Fragen geht es in Sieghart Döhrings und Anselm Gerhardts Aufsätzen zu Spontinis und Webers Arien(formen), wobei sowohl bei Weber wie bei Spontini eine merkwürdige Gleichzeitigkeit von Tradition und Innovation auffällt – und Spontini als Meister irregulärer Verläufe und, noch vor Bellini, sehr langer Melodien charakterisiert wird, dessen vibrierende Moderne, bei allem glucknahem Ton, unüberhörbar ist, weil der Begriff des „Klassizismus“ eben nicht auf einen blutleeren Körper reduziert werden kann. Kenner von La Vestale, Fernand Cortez und Olympia, aber auch von Agnes von Hohenstaufen, der wohl seltensten und unterschätztesten der großen Spontini-Opern, wissen, wovon der Rezensent redet, der sich darüber freut, dass Norbert Millers Wort über Olympia zitiert wird: sie sei „nach Anlage und Meisterschaft der Durchführung, nach Erfindungskraft und reflektierter Beherrschung aller Mittel das größte“. Die Frage bleibt nur: Welche Olympia ist gemeint, wenn von ihr die Rede ist? Spontini hat auch von Fernand Cortez mehrere Fassungen erstellt; Klaus Pietschmann hat die vierte, die „Berliner“ Fassung und den neuen, betont christlich inspirierten Schluss untersucht (die Wagner kannte und für seinen Rienzi nutzte) und sehr genau mit den politischen Umständen in Zusammenhang gebracht, die es uns erlauben, in den großen Opern Spontinis konkrete Reflexionen auf die Napoleonische Glanzära, dann auf die antinapoleonische Koalitionspolitik einer „Heiligen Allianz“ zu sehen. La Vestale, Fernand Cortez, Olympia und Agnes von Hohenstaufen, sie waren auf ihre Weise Propaganda-Objekte und -Subjekte der verschiedensten Regime. Wer in den 1820er Jahren Die Vestalin besuchte, tat es auch aus patriotischem Antrieb, was Rückschlüsse auf eine nationalistische Radikalisierung von vornherein ausschließt, denn immerhin war es ja der „welsche“ Komponist, der den Preußen das Material für eine antifranzösische Opernpropaganda geliefert hatte.
So verschwisterten sich Werk und Wirkung, Mythos und Moderne, Geschlecht und Gegenwart. Ob die antiken Vestalinnen, deren Geschichte(n) im Hintergrund der Vestalin stehen, im römischen Bewusstsein und ganz konkret als (theoretische) Reproduktionsmaschinen jedoch eine eindeutig findbare Propagandafunktion hatten und die „genetische Konstanz des Staates garantieren“ sollten, während es ihnen bei Todesstrafe verboten war, während ihres dreißigjährigen Dienstes sexuelle Beziehungen einzugehen, d.h.: Kinder zu gebären, sei dahin gestellt, weil sich Religion zumal dann nicht immer logisch deuten lässt, wenn die Quellen nicht allzu reichlich fließen. Der Versuch Tina Hartmanns, das Institut der Vestalinnen gendertechnisch abzuklopfen, kommt m.M. nach dort an eine Grenze, wo Hypothesen mit dem zur Verfügung stehenden Material nur sehr schwer beweisbar sind und die Dialektik einer männlichen Anti-Aufklärung bruchlos rationalisiert wird. Doch die Präsentation einschlägiger Porträts von Damen der höheren Gesellschaft als Vestapriesterinnen – zwischen der elisabethanischen Renaissance und dem späten 18. Jahrhundert – offenbart den Raum, in dem irgendwann auch La Vestale mit seinen machistischen Zügen Einzug hielt und die frauenfeindlichen, auf die Vernichtung der weiblichen Emanzipation zielenden Tendenzen der Französischen Revolution verwandelt wiederkehren. Die Oper und die aktuelle Politik, das Thema wird mit einigen Beiträgen tiefenscharf beleuchtet.
Genaueres zur Quellenfrage erfahren wir von Matthias Brzoska, der einen guten kursorischen Überblick über die Quellen zur von Spontini und Hoffmann erstellten Neufassung der Olimpie gibt. Der Weber-Kenner Joachim Veit widmet sich der Euryanthe und erläutert sehr genau, wie Weber manch Passage und Stück zwischen Entwurf und Partitur formulierte, bevor im späteren Aufführungsmaterial das eine oder andere Detail unzulässig verschliffen wurde; der betreffende Band innerhalb der Weber-Gesamtausgabe ist endlich für 2025 angekündigt worden. Spannend auch der Entstehungsprozess des Librettos, den Solveig Schreiter, der wir eine exzellente Freischütz-Edition verdanken, beschreibt, um die Striche und Modifikationen verschiedener Textstufen genau einzuordnen. Zu den Quellen gehören auch die Theaterzettel und Hinweise in den zeitgenössischen Zeitungen, in denen die Sängerinnen und Sänger genannt wurden, die, zumindest bei Weber, unbewusst darüber bestimmten, wie eine Rolle zu klingen hat. Thomas Seedorf widmet sich dem Freischütz und kann zeigen, wie genau der Komponist die Rollen den jeweiligen Profilen anglich. All das ist im Großen bekannt, aber en detail immer wieder erhellend zu erfahren. In das Gebiet der seinerzeitigen Opernpolemik gerät man, wenn man mit Arnold Jacobshagen die Rolle Rossinis in Berlin betrachtet. Berlin schlug mit der Bevorzugung Spontinis vor Rossini, der hier weit weniger erfolgreich war als in Wien, einen Sonderweg ein, und Der Freischütz wurde im Zeitraum 1818-1825 öfter gespielt als alle Rossini-Opern zusammen. Wenn Jacobshagen die geistfreien Angriffe gegen den italienischen Großmeister der Oper zitiert, bekommt man auch einen Eindruck vom Kampf, den Marx gegen Hegel führte – also der Musikpublizist Adolf Bernhard Marx gegen den Rossini-Liebhaber.
Und so geht es weiter: mit Ursula Kramers Aufsatz über die Konvergenz der Gattungen Oper und Schauspielmusik (wobei der heute fast vergessene Bernhard Anselm Weber die Hauptrolle spielt), die es schwer macht, streng zwischen dem Freischütz und der Deodata zu unterscheiden; dass sich der jüngere Weber vom älteren inspirieren ließ, steht außer Frage. Dies sind so Funde eines Bandes, der zuletzt tief in die öffentlichen und privaten Konzerthäuser und Tanzböden im Berlin der 1820er Jahre hineinleuchtet, in der neben den von Christoph Henzel gelisteten geistlichen Stücken auch ganz selbstverständlich Opern-Piècen und neben Tanzsätzen nach angesagten Opernschlagern (wie sie Lavinia Hantelmann anschaulich beschreibt) Sonaten auf der Grundlage von neuesten Hits erklangen. Axel Beer, der sich tief in das noch eher apokryphe Gebiet der zeitgenössischen „Opernderivate“ hineingearbeitet hat, kommt schließlich zur berechtigten Forderung, sich der damaligen Lebenswirklichkeit zuzuwenden und „die Bandbreite dessen zu rekonstruieren, in welchen Darreichungsformen die Liebhaber Schaft am häuslichen Klavier – jedenfalls in privatem Ambiente – Oper konsumierte und sich, vor dem Hintergrund welcher Wünsche auch immer, delektierte“.
Es muss ja nicht immer „Große“ Oper sein – aber v. A. Spontini und den Raum der Berliner Oper, in dem vor 200 Jahren die nach wie vor hinreißenden, aber heute eher unbekannten Kassenschlager die Massen anlockten, mit Einzelstudien und souveränen Überblicksdarstellungen zu würdigen, war eine sehr gute Idee. Insofern: tatsächlich eine Inspiration, sich mal wieder intensiv mit der Opernkultur zwischen der Olympia und dem Freischütz zu befassen.
Frank Piontek, 14. April 2025
Fabian Kolb (Hrsg.): Zwischen Olympia und Freischütz.
Oper in Berlin im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts.
Königshausen & Neumann, 2024.
374 Seiten, 83 auch farbige Abbildungen. 58 Euro.
