Auch in diesem Jahr haben wir unsere Kritiker wieder gebeten, eine persönliche Bilanz zur zurückliegenden Saison zu ziehen. Wieder gilt: Ein „Opernhaus des Jahres“ können wir nicht küren. Unsere Kritiker kommen zwar viel herum. Aber den Anspruch, einen repräsentativen Überblick über die Musiktheater im deutschsprachigen Raum zu haben, wird keine Einzelperson erheben können. Die meisten unserer Kritiker haben regionale Schwerpunkte, innerhalb derer sie sich oft sämtliche Produktionen eines Opernhauses ansehen. Daher sind sie in der Lage, eine seriöse, aber natürlich höchst subjektive Saisonbilanz für eine Region oder ein bestimmtes Haus zu ziehen.
Nach dem Harztheater in Quedlinburg und Halberstadt blicken wir heute auf das Theater Aachen.
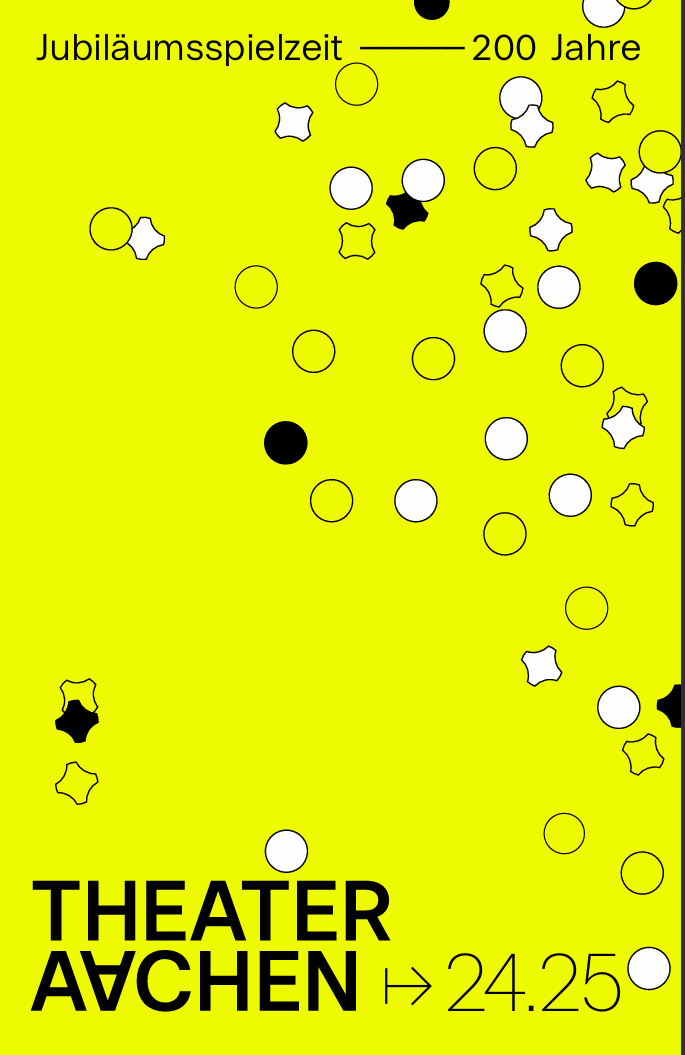
Am 15. Mai 1825, also vor 200 Jahren, öffnete das Theater Aachen mit Louis Spohrs Oper Jessonda seine Pforten. Mit einem Festakt einer großen Ausstellung und diversen Veranstaltungen, die bis in die nächste Saison greifen, feiert das Theater der Kaiserstadt den denkwürdigen Geburtstag. In den Opern- und Konzertspielplänen schlägt sich das Ereignis, zumindest in der vergangenen Spielzeit, allerdings nur marginal nieder. Gegen Ende der Saison allenfalls in Giuseppe Verdis Oper Ernani, deren dritter Akt im Aachener Dom spielt. In zwei früheren Produktionen, Mozarts Zauberflöte und Jacques Offenbachs Opéra bouffe Orphée aux enfers (Orpheus in der Unterwelt), stellten vor allem die Bühnenbildner einen Bezug zu Aachen und seinem Theater her. Tim Berresheim empfand Sarastros Weisheitstempel in der Zauberflöte dem klassizistischen, von Johann Peter Cremer entworfenen und von Friedrich Karl Schinkel noch veredelten Portal des Aachener Theaters nach. Und das pittoreske Dach des Gebäudes diente auch als Vorlage für den Olymp in Offenbachs Paradestück. Hier reicherte Michiel Dijkema die Anzüglichkeiten durch Anspielungen auf die Baustelle im Umfeld des Theaters an. Und Orpheus reitet auf der Pferde-Statue des Vorplatzes auf die Bühne.
Dijkema, der zugleich Regie führt, hat sich bereits im letzten Jahr mit Rossinis Buffa Il Viaggio a Reims als Meister der musikalischen Komödie empfohlen. Allerdings tut man sich in Deutschland mit dem feinen Esprit Offenbachs schwerer als mit dem Brio Rossinis. Hielt sich die Kalauer-Dichte in Dijkemas Rossini-Inszenierung noch in Grenzen, ließ er es bei Offenbach eine Klasse gröber krachen. Immerhin sparte die Produktion nicht an szenischer Opulenz, zu der auch die eindrucksvolle Kostümparade von Jackie Tadéoni beitrug. Und Dijkema brachte mit der geschickten und effektvollen Führung von Chor und Statisterie einschließlich flotter Tanzeinlagen viel Leben und Turbulenz auf die Bühne.
Auch musikalisch wurde eher der Säbel geschwungen, weniger das feinere Florett. Kapellmeister André Callegaro sorgte vor allem für Tempo und dynamischen Druck. An Spielfreude mangelte es auch dem Ensemble nicht, das Intendantin Elena Tzavara mit ihrem Amtsantritt vor anderthalb Jahren wesentlich verjüngte. Das kam bei Offenbach gut an, bei dem man über manche stimmlichen Ecken und Kanten hinweghören sollte.
In der Zauberflöte zeigte sich allerdings, dass noch nicht jeder der neuen Kräfte zu stimmlicher Stabilität gefunden hat. Mit Ausnahme von Alma Ruoqi Sun als Königin der Nacht und Jorge Ruvalcabas in der nicht ganz so anspruchsvollen Partie des Papageno taten sich die Sänger recht schwer mit den Ansprüchen vorbildlichen Mozart-Gesangs. Auch Ángel Macias als Tamino, der im Vorjahr als Rudolfo in der Bohème wesentlich stärker überzeugen konnte.
Von einer vokalen Offenbarung war die Mozart-Produktion also weit entfernt, zumal auch Generalmusikdirektor Christopher Ward alles andere als sensibel durch den Abend führte.
Ward, der seit acht Jahren das musikalische Niveau in Oper und Konzert auf einem hörenswerten Standard hält, wird Aachen allerdings mit Ende der nächsten Saison 2026 verlassen. Aus rein privaten, keinesfalls künstlerischen Gründen.
Auch nicht wegen der konzeptionellen Orientierung der neuen Intendantin an spartenübergreifenden Formaten, wie zum Auftakt in ihren ersten beiden Saisons mit Henry Purcells zwischen Schauspiel und Oper changierenden Gattungs-Zwittern King Arthur und The Indian Queen. Auch Versuche, Musiktheaterprojekte aus dem Stammhaus in andere Spielstätten zu verlagern, gehören zu Tzavaras Neuerungen. So gab es die Aufführung eines „Straßenoratoriums“ von und mit Schorsch Kamerun mit Chormusik von Roland Schwab, das mit einem 60-köpfigen Bürger-Chor an verschiedenen Plätzen der Stadt aufgeführt wurde.
Zum Abschluss der Saison haben sich Intendantin Elena Tzavara und Generalmusikdirektor Christopher Ward etwas Besonderes einfallen lassen. Auf der Suche nach Stoffen mit Bezügen zur Stadt Aachen stießen sie auf Giuseppe Verdis frühe Oper Ernani, in der der spanische König Carlos im dritten Akt im Aachener Dom zum Kaiser Karl V. gekrönt wird. Kurzerhand verlegte man diese Szene ins imposante Oktogon des Doms, so dass das Publikum in der Pause den etwa 300 Meter langen Weg vom Theater zum Dom zu Fuß zurücklegen und anschließend für den Rest des Stücks ins Theater zurückkehren musste.
Bis in der Premiere alle Rollatoren am Dom geparkt waren, verging einige Zeit, und als der Wettergott zürnte, wurde das Opernerlebnis zu einem feuchten und zweifelhaften Vergnügen. Genau dieses Schicksal ereilte die Premierenbesucher, als sich auf dem Rückweg der Himmel für einen tsunamiartigen Wolkenbruch öffnete und die Wanderer bis auf die Haut durchnässte, ohne rechtzeitig einen Regenschutz finden zu können. Mit stoischer Gelassenheit führte die Garde des Aachener Karnevalsvereins „Öcher Penn“ den erfrischten, aber nicht sehr fröhlichen Zug an.
Die Verbundenheit mit der Aachener Bevölkerung unterstrich man, indem zur finalen Hochzeitsszene jeweils 80 Bürger einlud, auf der Bühne an der Festtafel Platz zu nehmen, wo sie allerdings eher dem Chor im Wege saßen als erhellende Eindrücke vermitteln zu können.
Den verwickelten Handlungsablauf des Stücks, in dem gleich drei hochgestellte Herren, eingeschlossen der spätere Kaiser Karl V., um die Hand der schönen Elvira buhlen, einigermaßen glaubwürdig und stringent in Szene zu setzen, versuchte das 2015 in Basel gegründete Musiktheaterkollektiv AGORA erst gar nicht. Im Dreierteam griffen Anna Brunnlechner, Valentin Köhler und Benjamin David die Brüche, Ecken und Kanten des Werks auf und nutzen sie bewusst, um sie in ein eigenes Format zu führen.
Das taten sie, indem sie jedem Bild eine Figur zuordneten. So entstand eine Art Stationendrama mit dem Gang zum Dom als spektakulärem Höhepunkt. Der erste Akt war dem Titelhelden, dem Räuberhauptmann Ernani, gewidmet und dem frühen 16. Jahrhundert nachempfunden. Elvira, das Objekt der Begierde der Männer, trat in den Kulissen des venezianischen Teatro Felice auf, in dem die Oper 1841 uraufgeführt wurde. Bevor im dritten Akt der spanische König Don Carlos, der zweite Verehrer Elviras, in der authentischen Kulisse des Doms zum Kaiser Karl V. ausgerufen wurde, befanden wir uns im modernen Salon des dritten Buhlen Don Silva. Und nach der Krönung ging es wieder zurück ins Theater, wo die Hochzeit von Ernani und Elvira vorbereitet wurde, die jedoch Herzog Silva vereitelte. In einer alle Zeitzonen vermischenden Umgebung durften dem finalen Festmahl dann 80 vor jeder Aufführung ausgewählte Zuschauer als Hochzeitsgäste auf der Bühne beiwohnen.
Das einst sehr erfolgreiche, heute nur noch selten aufgeführte Frühwerk entpuppt sich als inhaltlich wüste, historische Hintergründe mit privaten Liebesaffären und Rache-Akten verwickelnde Talentprobe Verdis nach einer nahezu vergessenen Dramenvorlage Victor Hugos. An melodischem Süßstoff und dramatischer Schlagkraft sparte der damals 30-jährige Komponist nicht, so dass ein effektvoller Opernabend garantiert war. Auch wenn die Figuren psychologisch recht grob geschnitzt und von den subtil profilierten Charakteren seiner späteren Protagonisten noch weit entfernt sind.
Der scheidende Aachener Generalmusikdirektor Christopher Ward ließ es im Orchestergraben mächtig krachen, wodurch auch die Chorauftritte an Druck gewannen. Bei der Besetzung der vier Hauptrollen hat man lediglich mit der Sopranistin Larisa Akbari auf ein Ensemblemitglied zurückgegriffen, die die anspruchsvolle, gesanglich dankbare, vom Profil her allerdings recht passiv und unterwürfig gestrickte Rolle der Elvira vorzüglich ausführte. Die drei Galane blieben Gästen vorbehalten, die allesamt überzeugten. Der Tenor Michael Ha als Ernani ebenso wie die Bassisten Hrólfur Sæmundsson als Don Carlos und Vladislav Solodyagin als Silva.
Insgesamt war dies eine Saison mit sehr persönlichen Akzenten der Intendantin. Gespickt mit Raritäten und spartenübergreifenden Zwittern und nur wenig Standardrepertoire, was in Aachen nicht nur Zustimmung fand, sondern auch auf Kritik stieß. Nach der 17-jährigen Amtszeit von Michael Schmitz-Aufterbeck, der sich geschickt um ein sehr ausgewogenes Angebot bemühte, hat es seine junge Nachfolgerin mit ihren Konzepten nicht ganz leicht. Zudem auch noch nicht jeder des jungen Ensembles zu seiner Form gefunden hat.
In der nächsten Saison wird es mit Zugstücken wie My Fair Lady, Alice im Wunderland als Familienstück, Donizettis L’Elisir d’amore und Tschaikowskys Eugen Onegin etwas populärer zugehen. Ergänzt durch Bachs Johannes-Passion als Tanztheater und die Uraufführung von Karola Obermüllers Oper Malina als Verbeugung vor komponierenden Frauen.
Etwas befremdlich wirkt die Praxis, die in Kooperation mit der Musikhochschule erarbeiteten Einakter Suor Angelica von Puccini und Herzog Blaubarts Burg von Béla Bartók an zwei Abenden aufzuführen.
Was die für den September geplante große Ausstellung zur 200-jährigen Geschichte des Aachener Theaters angeht, wird natürlich an ehemalige Generalmusikdirektoren erinnert, die von Aachen aus ihre grandiosen Karrieren starteten wie etwa Fritz Busch, Herbert von Karajan und Wolfgang Sawallisch.
Mit einer umstrittenen Maßnahme löste Elena Tzavara im November 2023 allerdings eine heftige Diskussion aus, als sie sich, bestärkt durch Veröffentlichungen des Karajan-Forschers Klaus Riehle, entschloss, die Büste Karajans wegen dessen Verstrickungem im Dritten Reich aus dem Foyer des Theaters zu verbannen. Dabei ist Karajans Vergangenheit als NSDAP-Mitglied und willfähriger Mitläufer spätestens seit Fred K. Priebergs vor 43 Jahren erschienenem Buch „Musik im NS-Staat“ allgemein bekannt. Der Informationsgewinn durch Riehles Erkenntnisse hält sich in Grenzen.
Jetzt ziert eine Mozart-Büste den Platz des einstigen Generalmusikdirektors, in dessen Glanz sich das Theater jahrzehntelang sonnte. Verschrottet wurde die Bronze der in Ungnade gefallenen Lichtgestalt freilich nicht. Sie hat einen Platz im Stadtmuseum Centre Charlemagne gefunden, das in der von ihm ausgerichteten Ausstellung die Rolle des Aachener Theaters im Dritten Reich ausführlich dokumentieren will.
Die Bilanz zog Pedro Obiera.
Produktionen dieses Opernhauses werden auch berücksichtigt in folgender Bilanz:
