Auch in diesem Jahr haben wir unsere Kritiker wieder gebeten, eine persönliche Bilanz zur zurückliegenden Saison zu ziehen. Wieder gilt: Ein „Opernhaus des Jahres“ können wir nicht küren. Unsere Kritiker kommen zwar viel herum. Aber den Anspruch, einen repräsentativen Überblick über die Musiktheater im deutschsprachigen Raum zu haben, wird keine Einzelperson erheben können. Die meisten unserer Kritiker haben regionale Schwerpunkte, innerhalb derer sie sich oft sämtliche Produktionen eines Opernhauses ansehen. Daher sind sie in der Lage, eine seriöse, aber natürlich höchst subjektive Saisonbilanz für eine Region oder ein bestimmtes Haus zu ziehen.
Nach der Semperoper Dresden blicken wir heute auf die Oper Frankfurt.
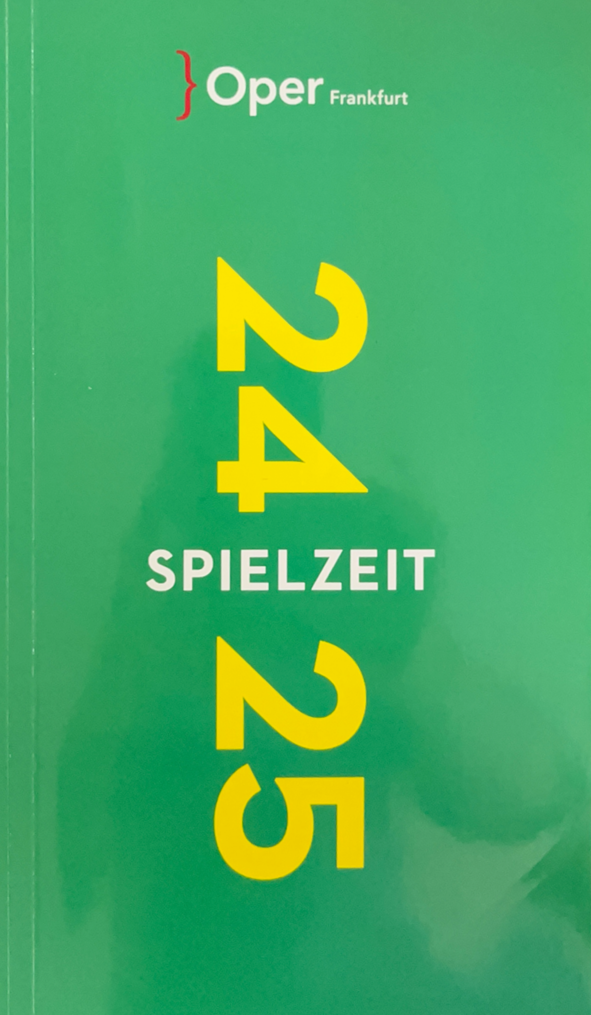
Bei elf Neuproduktionen und 14 Wiederaufnahmen besteht die Qual der Wahl. Nicht eine der Premieren war ein Reinfall, nicht eine der Wiederaufnahmen war mißlungen. Wenn hier die Spitzenleistungen herausgestellt werden, dann sind es Ergebnisse der Abstufung zwischen gut, sehr gut und herausragend.
Beste Produktion:
L’invisible. Eine Produktion, die szenisch, sängerisch und orchestral die ausgezeichnete Uraufführung in Berlin übertroffen hat. Zusammen mit Melusine im Bockenheimer Depot hat die Oper Frankfurt dem vor einem Jahr verstorbenen Jahrhundert-Komponisten Aribert Reimann ein Denkmal gesetzt.
Daß daneben mit Prinz von Homburg, Lulu und Guercœur Meisterwerke des 20. Jahrhunderts in glänzenden Neuproduktionen präsentiert worden sind, zeigt eine weit und breit beispiellose Spielplangestaltung. Die Wetten stehen gut, daß der Rekordhalter seinen Titel „Opernhaus des Jahres“ behaupten kann.
Größte Enttäuschung:
Keine Enttäuschung, aber eine Ernüchterung: Die zwar teilweise recht kurzweilige, aber leichtgewichtige Regie von Brigitte Fassbaender zu Parsifal verweigert sich mit Ansage einer Deutung und kann (und will) nicht mit dem spektakulären Tannhäuser des Vorjahres mithalten.
Entdeckung des Jahres:
Guercœur. Ein überzeugendes Plädoyer für ein Werk mit einer eigenständigen Musiksprache zwischen Wagners Parsifal und Debussys Pelléas. Szenisch wurde der Beweis der Bühnentauglichkeit erbracht.
Beste Wiederaufnahme:
Der Doppelabend La damoiselle élue / Jeanne d’Arc au bûcher: Visuell starke, mal poetische, mal drastisch-plastische Inszenierung, fabelhaft gesungen von Chor und Solisten, fabelhaft musiziert vom Orchester unter Titus Engel, szenisch frisch und präzise wiedereinstudiert, mit einer fulminanten Johanna Wokalek als Jeanne d’Arc.
Beste Gesangsleistung (Hauptpartie):
- Ensemble, Herren:
Andreas Bauer Kanabas als Gurnemanz. Sonor im Klang, mustergültig in der Diktion, bezwingend in der Gestaltung. Seinetwegen erscheint der erste Parsifal-Aufzug so kurzweilig wie sonst kaum irgendwo.
Er schlägt damit knapp Domen Križaj, der mit dem Prinzen von Homburg, Einsätzen als Macbeth, in der Titelpartie von Guercœur und als Gorjancikov im Totenhaus zum zentralen Sänger der Spielzeit avanciert ist, und Nicholas Brownlee, der längst ein international begehrter Heldenbariton ist und in seiner vorletzten Spielzeit als Ensemblemitglied als Macbeth und Amfortas glänzen durfte. - Ensemble, Damen:
Internationale Karriere hin oder her: Claudia Mahnke bleibt im Ensemble und beglückt mit ihrem in dunkler Glut lodernden Mezzo als Gräfin Geschwitz in Lulu und Giselle in Guercœur. - Gastsängerin:
Frankfurt ist ein Ensemble-Haus. Auch und gerade Hauptpartien besetzt man aus Bordmitteln. Und so ist von den wenigen Gästen in einer tragenden Partie ausgerechnet eine Einspringerin in Erinnerung geblieben: Signe Heiberg hat als Lady Macbeth die Premiere im Dezember gerettet und das Publikum mit einer staunenswerte Fülle an Klangfarben vom Bühnenrand aus hingerissen. In der kommenden Spielzeit kehrt Heiberg als Lady zurück und darf sich dieses Mal auch darstellerisch beweisen. - Gastsänger:
Noch ein Einspringer: Franko Klisović zeigte als Arsace in Partenope einen wunderbar weichen, betörend schönen und zugleich kraftvollen Countertenor mit geradezu muskelbepackten Koloraturen.
Beste Gesangsleistung (Nebenrolle):
- Herren:
Kihwan Sim, der als Löwenbändiger und Athlet in Lulu bewiesen hat, daß es Zwölfton-Belcanto gibt.
Auch Liviu Holender hat als Graf von Lusignan in Melusine mit warmem Bariton gezeigt, daß die Schönheit des Gesangs außerhalb der Tonalität wirken kann.
- Damen:
Karolina Bengtsson, die mit ihrer runden, blühenden Prachtstimme immer noch auf angemessene Einsätze wartet und einstweilen als Barbarina in Le Nozze di Figaro und Aljeja im Totenhaus auf ihr Potential aufmerksam gemacht hat.
Bestes Dirigat:
Thomas Guggeis. Der Honeymoon des Orchesters mit seinem jungen Chef dauert auch im zweiten Jahr an. Man muß sich nur einmal bei den Videos unter dem Titel „Deep dive“ anschauen, wie der schmächtige junge Mann sich mit einem Klavierauszug am Flügel in die Musik stürzt, Analyse und Leidenschaft miteinander verbindet, um zu erkennen, warum er für das Amt des Generalmusikdirektors ein Glücksgriff ist. Egal ob Lulu oder Macbeth, Wiederaufnahmen von Lady Macbeth von Mzensk oder Rosenkavalier: Hier geschieht im Orchestergraben Außerordentliches. Wer das für die übliche Lobhudelei des Frankfurter Stammkritikers im lokalpatriotischen Dauereinsatz hält, der lese die Kritik des Bayreuth- und München-verwöhnten Kollegen Piontek zum Dirigat bei Macbeth: „Phänomenal“.
Beste Regie:
David Hermann für Guercœur. Dem Regisseur gelingt eine ebenso plausible und spannende wie szenisch attraktive Verknüpfung der oratorienhaften mit den dramatischen Elementen der Vorlage, von allegorischen und realen Handlungssträngen. Selbst für den ausfransenden Schlußakt findet er eine überzeugende Lösung. Kongenial.
Bestes Bühnenbild:
Kaspar Glarner hat seine Vielseitigkeit mit dem Rokoko-Bühnenfest bei Le postillon de Lonjumeau, der brillanten Verknüpfung einer Schwarz-Weiß-Skizze mit augenzwinkerndem Lokalkolorit und punktgenau eingesetzten Videoeffekten bei Doktor und Apotheker und schließlich der surreal verrätselten Traumwelt in Alcina unter Beweis gestellt.
Beste Chorleistung:
Der Chorleiter ist nach New York entschwunden, Gäste geben sich als Ersatz die Klinke in die Hand. Besonders Virginie Déjos hat das Kollektiv bei seinen ausgedehnten Einsätzen in Guercœur zu Homogenität, Präzision und Klangfülle motiviert.
Größtes Ärgernis:
Kein wirkliches Ärgernis, aber ein Bedauern: Darüber daß die Intendanz beliebte, ja mitunter ikonische Produktionen aus dem Repertoire nimmt, um sie durch Neuinszenierungen derselben Werke zu ersetzen, deren szenische Qualität die Absetzung jedenfalls nicht zwingend erscheinen läßt. Niemand hätte etwa den kurz vor Corona herausgebrachten, sehr blassen, statischen, szenisch todlangweiligen Tristan gebraucht, niemand die aseptische neue Zauberflöte (angeblich „für Erwachsene“), und auch der neue Parsifal kann die Erinnerung an Jens Kilians Bühnenbild und Christof Nels Deutung von 2006 nicht auslöschen.
Die Bilanz zog Michael Demel.
Produktionen dieses Opernhauses werden auch berücksichtigt von:
Reisebilanz II
Reisebilanz VI
Reisebilanz VIII
