Mit der Bilanz zum Teatro alla Scala, Mailand haben wir den letzten nur auf ein einziges Haus beschränkten Rückblick präsentiert. Nun folgen Bilanzen, die mehrere Theater einer Großstadt oder einer Region zusammenfassen. Wir beginnen mit den drei Pariser Häusern: der Opéra National de Paris (Opéra Bastille und Palais Garnier), dem Théâtre national de l’Opéra Comique und dem Théâtre des Champs-Elysées (als Bonus ein kleiner Seitenblick nach Budapest).
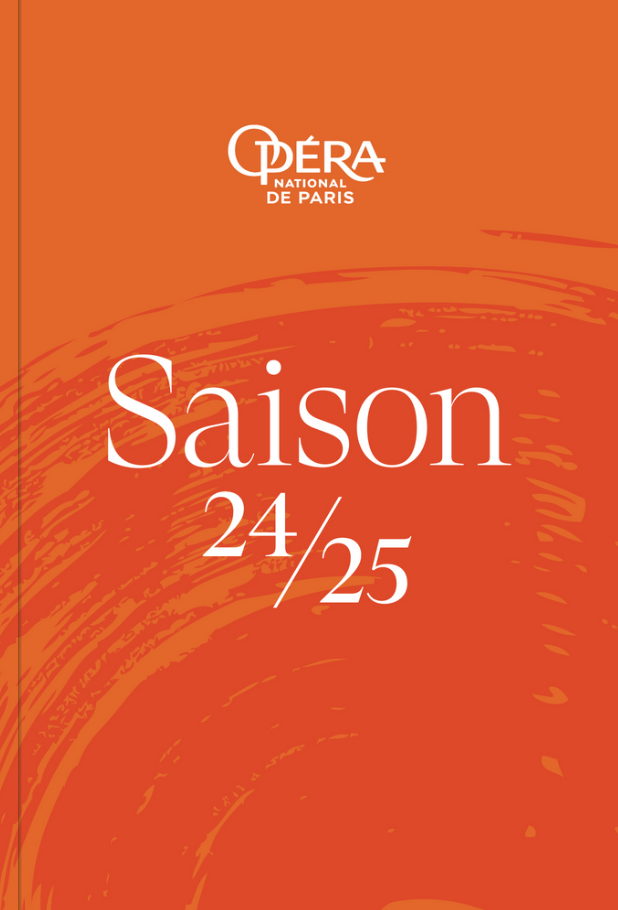


Beste Produktion / Gesamtleistung:
Faust von Charles Gounod, in der Urfassung aus 1859 an der Opéra Comique (Koproduktion mit der Opéra de Lille und dem Palazzetto Bru Zane)
Ein Aha-Erlebnis: Man glaubt ein Werk seit Langem zu kennen, kann sich nicht ganz damit anfreunden und eines Tages hört und sieht man es ganz neu. So erging es mir 2003 im Théâtre du Châtelet (hoffentlich bald wieder ein Opernhaus!) mit Les Troyens von Hector Berlioz. Ich kannte diese nur als „wuchtigen Wagner“ (Opéra Bastille, Salzburg etc), der immer irgendwie enttäuschend blieb. Doch mit ursprünglicher Tonart und Orginal-Instrumenten ging plötzlich die Rechnung auf. So jetzt auch mit der Urfassung von Faust, die 1859 im Théâtre Lyrique aufgeführt wurde – quasi einem Boulevard-Theater. Ohne die berühmten Arien, die erst später für die Pariser Oper und die Eröffnung der Metroplitan Opera in New York etc. dazu kamen, und ohne die fast moralisierende Religiosität. Denn Faust war ursprünglich – das wird erst jetzt entdeckt – eine bunte und freche opéra-comique de demi-caractère (wie Psyché von Ambroise Thomas, siehe unten). Dies wurde musikalisch und szenisch fantastisch umgesetzt: ein rasender Erfolg und nicht nur für mich die beste Produktion der Spielzeit (leider konnte ich aus Termingründen keine Rezension schreiben).
Größte Enttäuschung:
Rheingold an der Pariser Oper in der Regie von Calixto Bieito
Welches Projekt hat schon so einen langen Vorlauf: es sollte der lang vorbereitete Abschied von Philippe Jordan werden, doch die End-Proben mussten im März 2020 Pandemiebedingt abgebrochen werden. Fünf Jahre später gelang der dritte Anlauf der immer noch gleichen Produktion, mit inzwischen mit einem neuen Dirigenten und einer neuen Besetzung. Doch am Premierenabend wirkte die Inszenierung erstaunlich „unausgegoren“: ein Wirrwarr von Ideen, die oft nicht zueinander passten und sich gegenseitig annullierten, teilweise stümperhaft umgesetzt und so viele szenische Peinlichkeiten, als ob der Regisseur nicht fünf Jahre, sondern nur 5 Tage Vorbereitung gehabt hätte.
Entdeckung des Jahres:
Psyché von Ambroise Thomas am Müpa in Budapest
Eine wirkliche Überraschung – wir hatten uns ehrlich gesagt nicht so viel davon erwartet. Denn von den 19 Opern des damals in Paris sehr beliebten Ambroise Thomas kennt man heute nur noch Mignon und Hamlet. Und diese sind streckenweise recht konventionell: wunderschöne Arien mit dazwischen uninspirierter und uninspirierender „Füllmusik“. Doch diese unbekannte Oper, seit 1878 nicht mehr gespielt, ist ein wirkliches Juwel und ohne eine Sekunde Langeweile: raffinierte leichte Kost, mit einem spritzig-erotischen Libretto und ganz wunderbarer Musik. Jetzt versteht man erst 150 Jahre später, warum Ambroise Thomas damals so beliebt war und entdeckt eine vergessene Opernform: weder klassische Oper, noch komische Oper, sondern opéra-comique de demi-caractère.
Beste Wiederaufnahme:
Le Domino Noir von Daniel-François-Esprit Auber an der Opéra Comique
Eine Komödie, so spritzig wie die Fledermaus, perfekt szenisch, musikalisch, sängerisch und tänzerisch umgesetzt. Besonders hat uns gefallen, dass der ganze Bühnenzauber mit „handgemachten“ Bühnenmitteln entstand, ohne die heute so überpräsente Technik (Film, Video etc). So einfach kann ein vergnüglicher Abend sein!
Beste Gesangsleistung (Hauptpartie):
Julien Dran (Faust), Jérome Bouteiller (Méphistophélès) und Vannina Santoni (Marguerite) in der Urfassung von Faust an der Opéra Comique
Eine Teamleistung der Sänger-Schauspieler: Sie sangen nicht nur wunderbar (Faust und Méphistophélès mit teilweise höllisch schwierigen Verzierungen), sondern spielten den ganzen Abend nicht nur was in der Partitur steht, sondern auch ohne Text. Eben richtige „Darsteller“.
Beste Gesangsleistung (Nebenrolle):
Anna Maria Labin als Dalila in Samson von Jean-Philippe Rameau an der Opéra Comique
In diesem Werk (nach Voltaire, nur fragmentarisch erhalten und nun partiell rekonstruiert), ist Dalila nur eine „Nebenrolle“. Doch aus solchen weiß diese temperamentvolle Sängerin Hauptrollen zu machen, wie auch als Ginevra im konzertanten Ariodante von Händel an der Philharmonie de Paris.
Nachwuchssänger des Jahres:
Anas Séguin (Wagner) in der Urfassung von Faust an der Opéra Comique
Vor wenigen Jahren noch „révél ation de l’Adami“, geht es nun stetig bergauf. Das Talent ist überdeutlich da – bald werden sicher noch größere Rollen folgen.
Bestes Dirigat:
Das Rheingold-Dirigat von Pablo Heras-Casado an der Pariser Oper (trotz der Regie von Calixto Bieito)
Alles wurde gnadenlos in der französischen Presse verrissen, auch das Dirigat von Pablo Heras-Casado. Doch er war für mich der Stern des Abends: Er dirigierte trotz der wirren Regie mit großer Eleganz, federnd leicht, klug strukturiert, nie wuchtig, sondern mit großer Transparenz und ließ das Orchester stellenweise aufblühen, das ich quasi seit Philippe Jordan nicht mehr so gut gehört habe. Da gab es Nuancen, die sich mit denen der Wiener Philharmoniker messen lassen können: Weltklasse-Niveau.
Beste Regie:
Denis Podalydès für die Urfassung von Faust von Charles Gounod an der Opéra Comique
Was macht man heute mit französischen Opern, in denen es genauso viel gesprochenen wie gesungenen Text gibt? Man kürzt ihn gewaltig, schreibt ihn neu (siehe Barrie Kosky unten) oder nimmt eine spätere Fassung mit Rezitativen (wie z.B. meist bei Carmen von Bizet). Doch Denis Podalydès, selbst ein begnadeter Schauspieler an der Comédie Française, weiß wie man mit Texten und Schauspielern umgehen kann und inszenierte das herrlich freche Libretto von Jules Barbier und Michel Carré wie ein Boulevard-Stück in dem auch gesungen wird. Er wurde dabei kongenial unterstützt durch den Dirigenten (und Direktor der Opéra Comique) Louis Langrée. Sie gaben dem staubigen Faust die neue Jugend von der er träumt. Ein neuer Meilenstein in der Werkgeschichte.
Bestes Bühnenbild:
Johannes Leiacker für Massenets Werther
(Übernahme am Théâtre des Champs-Elysées der Inszenierung von Christof Loy an der Scala) Einfach, elegant und intelligent: eine Einheitsbühne für alle vier Akte als „Vorzimmer eines nicht gelebten Lebens“ – so eine Bühne haben wir schon lange nicht mehr gesehen.
Beste Beleuchtung:
Roland Edrich für Massenets Werther
(Übernahme am Théâtre des Champs-Elysées der Inszenierung von Christof Loy an der Scala) Elegant und subtil changierend – auch das haben wir schon lange nicht mehr gesehen.
Beste Kostüme:
Christian Lacroix für die Urfassung von Faust an der Opéra Comique
Dass Christian Lacroix ein großer Kenner und Liebhaber von historischen Kostümen ist, wussten wir schon lange. Hier hat er sich übertroffen, weil er auch „kleine Leute“ absolut stilvoll einkleiden konnte. Ein großes Kompliment auch an das Kostümatelier der Opéra de Lille: jedes Detail saß!
Beste Choreographie:
Sasha Waltz für Bachs Johannes-Passion
(Übernahme am Théâtre des Champs-Elysées der Inszenierung an der Opéra de Dijon)
Wunderbare Zusammenarbeit von Sängern und Tänzern, eindrucksvoll, intelligent und, vor allem, sehr musikalisch. Wie viele Choreografen können heute noch Noten lesen?
Beste Chorleistung:
Der durch durch Csaba Somos vorbereitete Ungarische National Chor Nemetski Énnekar in Psyché von Ambroise Thomas am Müpa in Budapest
György Vashegyi dirigierte sehr behutsam das Ungarische Philharmonische Nationalorchester Nemzeti Fiharmonikus Zenekar. Doch besonders begeistert war ich durch den Chor, der die Nuancen einer opéra-comique de demi-caractère so fein umsetzte, wie ich es auch in Paris nicht oft höre. Quel raffinement! (Ab Oktober kann man es auf der Buch-CD Psyché des Palazzetto Bru Zane hören.)
Größtes Ärgernis:
Die fast schizophrene Diskrepanz zwischen Musik und Regie:
Nichts gegen neue Regieansätze, Humor bei Offenbach und auch nichts dagegen, wenn Barrie Kosky selbstverfasste Dialoge in ein Werk einschiebt – denn manche fand ich genial. Aber dieser Satz in seiner Inszenierung von Offenbachs Les Brigands am Palais Garnier ging mir einfach zu weit. Dass der Räuberhauptmann Falsacappa als nicht-binärer Transvestit mit sehr spärlich bekleideten Transgender-Banditen den Abend mit einem French Cancan eröffnet, fand ich schon etwas „over the top“. Dass er danach vom Vater zur „Mutter“ von Fiorella mutierte, befremdlich. Doch dann kam diese Warnung beim Heiratsantrag von Fragoletto, mit dem Fiorella „le sentier de la Vertu“ (der Weg der Tugend) einschlagen will, also heiraten: „Aber meine Tochter, in der kranken heterosexuellen Welt und in einer monogamen Ehe erwartet Dich nur Langeweile“. Dies ist ein Paradebeispiel für ein nun weitverbreitetes Ärgernis: im Rahmen des Offenbach-Jubiläums 2019 wurden viele seiner Werke neu editiert und die Intendanten profitieren nun davon. So habe ich ein dickes Dutzend dieser Raritäten rezensieren können, mit oft hervorragenden Dirigenten – wie hier Stefano Montanari. Doch anderseits laden diese gleichen Intendanten gleichzeitig dazu Regisseure ein, die das Werk quer oder queer inszenieren und sich dabei offensiv gegen die Partitur stellen. Wie Barrie Kosky, der im offiziellen Trailer der Pariser Oper sagte: „it should never sound like opera, never like 19th-century French opera, it must sound like a circus“. Und so gab es dann auf der Bühne nicht nur „Zirkus“ – es klang auch so und die ganze musikalische (Vor-)Arbeit war im Eimer…
Die Bilanz zog Waldemar Kamer.
Produktionen der Operá Garnier werden auch berücksichtigt von:
Reisebilanz II
