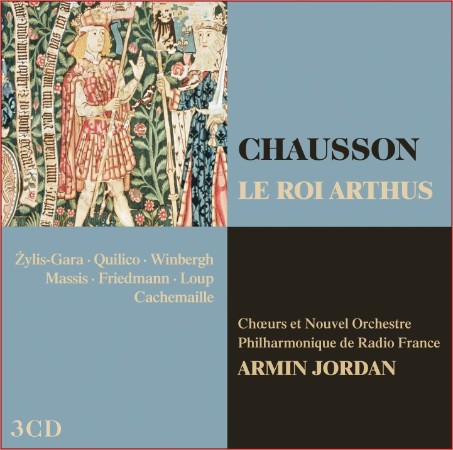11.6.2015 – Erstaufführung an der Pariser Oper!
(Ernest Chausson
Die französischen Opern-Ritter kehren zurück

Die edelmütigen, eleganten französischen Ritter des Mittelalters setzen an, um mit ihren schillernden Rüstungen und glimmenden Schwertern den Platz zurück zu erobern, den sie einst auf unseren Operbühnen fest in Händen hielten….
Die edelmütigen, eleganten französischen Ritter des Mittelalters setzen an, um mit ihren schillernden Rüstungen und glimmenden Schwertern den Platz zurück zu erobern, den sie einst auf unseren Opernbühnen fest in Händen hielten. Nachdem die deutsche Erstaufführung von „Sigurd“ von Ernest Reyer im Januar in Erfurt durch die internationale Presse als ein großes Ereignis gefeiert wurde, folgte im April die erste Aufführung seit 1919 von Massenets „Le Cid“ an der Pariser Oper, über die wir auch ausführlich berichtet haben. Und gleich danach stürmte schon eine dritte Ritterschar auf die Bühne: „Le Roi Arthus“ mit seiner legendenumwobenen „Tafelrunde“. Auch wenn die Schar durch Lancelot angeführt wird (und nicht durch Tristan oder Parzival), hat die einzige Oper von Chausson inhaltlich und musikalisch eine große Nähe zu Wagners „Tristan und Isolde“.

„Le Roi Arthus“ ist eine freie Nacherzählung der Legende von Tristan und Isolde in einem betont wagnerisch anmutenden Musikidiom, in dem Chausson die Konstellation der Personen geändert und den Schwerpunkt von der verbotenen Liebe auf die Vergänglichkeit des menschlichen Strebens verlagert hatte. Chausson verwendet oft nur kurze Tonfolgen aus Wagners Werken, vermischt diese dann mit impressionistischen Klängen à la Debussy und instrumentiert es wie César Franck. Daraus entsteht dann Chaussons „eigener“ Klang. Aber wie er z.B. nahtlos Übergänge von der „Götterdämmerung“ zu „Parsifal“ herstellen kann, davon kann heute noch der geniale Stefan Mickisch etwas lernen.
 Ernest Chausson (1855-1899) – heute hauptsächlich bekannt wegen seinen „Poèmes“ und „Symphonies“ die oft zusammen mit den Orchesterwerken von Debussy gespielt werden – war der Generalssekretär des französischen Musikerverbandes und ein Schüler von Massenet und César Franck. Mit ihnen (und vielen anderen Franzosen) „pilgerte“ er 1882 zur Uraufführung des „Parsifal“ nach Bayreuth, die ihn dazu anregte auch eine Oper zu schreiben. Doch der Schatten Wagners lastete sehr auf ihm und während der zehn Jahre dauernden Komposition von „Le Roi Arthus“ (1886-1895) schrieb Ernest Chausson verzweifelt an einen Freund: „Es ist vor allem dieser schreckliche Wagner, der mir den Weg versperrt. Ich bin wie eine Ameise, der sich ein riesiger Stein entgegenstellt. Es bedarf unzähliger Umwege, um den Pfad um diesen Stein zu finden.“ Und wegen Wagners mächtigem Schatten hat sich die Pariser Oper jahrelang geweigert „Le Roi Arthus“ aufzuführen. Auch Versuche die Oper in Brüssel, Genf, Wien, Dresden, Prag oder Karlsruhe herauszubringen scheiterten. Erst fünf Jahre nach dem plötzlichen Tod von Chausson setzte Vincent d’Indy 1904 eine Uraufführung des „Arthus“ durch in Brüssel, wo der „Wagnérisme“ sehr in Mode war.
Ernest Chausson (1855-1899) – heute hauptsächlich bekannt wegen seinen „Poèmes“ und „Symphonies“ die oft zusammen mit den Orchesterwerken von Debussy gespielt werden – war der Generalssekretär des französischen Musikerverbandes und ein Schüler von Massenet und César Franck. Mit ihnen (und vielen anderen Franzosen) „pilgerte“ er 1882 zur Uraufführung des „Parsifal“ nach Bayreuth, die ihn dazu anregte auch eine Oper zu schreiben. Doch der Schatten Wagners lastete sehr auf ihm und während der zehn Jahre dauernden Komposition von „Le Roi Arthus“ (1886-1895) schrieb Ernest Chausson verzweifelt an einen Freund: „Es ist vor allem dieser schreckliche Wagner, der mir den Weg versperrt. Ich bin wie eine Ameise, der sich ein riesiger Stein entgegenstellt. Es bedarf unzähliger Umwege, um den Pfad um diesen Stein zu finden.“ Und wegen Wagners mächtigem Schatten hat sich die Pariser Oper jahrelang geweigert „Le Roi Arthus“ aufzuführen. Auch Versuche die Oper in Brüssel, Genf, Wien, Dresden, Prag oder Karlsruhe herauszubringen scheiterten. Erst fünf Jahre nach dem plötzlichen Tod von Chausson setzte Vincent d’Indy 1904 eine Uraufführung des „Arthus“ durch in Brüssel, wo der „Wagnérisme“ sehr in Mode war.
Doch nach dem ersten Weltkrieg wollte das Publikum auch in Brüssel etwas Anderes hören und sehen als Krieger und Soldaten die mit erhobenem Schwert in die Schlacht ziehen, und so verschwand „Le Roi Arthus“ von den Spielplänen. Erst 1996 erschien er wieder und dann auch gleich drei Mal: in Dortmund, in Montpellier und in Bregenz. Es folgten Brüssel (2003) und Straßburg (2014). Leider nicht immer mit überzeugenden Aufführungen. Die Presse war so einstimmig negativ über den „Arthus“ in Strasbourg (siehe Merker 4/2014), dass nicht nur der Regisseur, Dirigent und die Besetzung, sondern auch das Werk selbst heftig kritisiert wurden. Die Pariser Oper scheint sich diese Kritik zu Herzen genommen zu haben und hat ihren „Arthus“ nun wirklich hochkarätig besetzt.

Roberto Alagna sang die ersten sieben Vorstellungen mit dem gleichen „Aplomb“ wie kurz zuvor den „Cid“ (siehe Merker 5/2015) und man kann dem Sänger, der sich seine Auftritte auswählen kann, nicht genug dankbar sein, dass er so kurz nacheinander zwei schwierige Rollen gelernt hat, die er wahrscheinlich nicht mehr oft singen wird. Denn Alagna besitzt genau diese „clarté“, dieses helle Metall in der Höhe, die den Typus des „französischen Heldentenors“ charakterisiert. Und dieser ist stimmlich viel „jugendlicher“ als ein Tristan, schon fast ein Pelléas mit Schwert und Rüstung. Man kann es der Pariser Oper jedoch nicht hoch genug anrechnen, dass sie es geschafft hat auch für die Zweitbesetzung eine mehr als nur beachtliche Lösung gefunden zu haben. In der Vorstellung am 11. Juni sang Zoran Todorovich den Lancelot. Seine Stimme besitzt zwar nicht die Geschmeidigkeit und Schönheit eines Alagna, aber die Stimme sitzt gut, verfügt über genügend Stahlkraft, und auch die Höhen wurden mühelos gemeistert.
 Zu Recht hat er dafür am Schluss einen großen persönlichen Erfolg errungen. Sophie Koch startete 2007 ihren Wechsel ins dramatischere Fach mit einer sehr eindrucksvollen Leistung als Margared in „Le Roi d’Ys“ von Édouard Lalo am Théâtre du Capitole in Toulouse. Seither hat sie auch weitere dramatische Partien in ihr Repertoire aufgenommen: die Brangäne, die Venus die Fricka und die Waltraute. Die Genièvre in „Le Roi Arthus“ kommt nun gerade im richtigen Moment. Die Rolle liegt ihr so gut in der Kehle als wäre diese Partie extra für sie geschrieben worden, aber leider wurde sie von der Regie total im Stich gelassen. Hoffentlich wird ihr noch einmal die Gelegenheit geboten diese Partie in einer anderen Inszenierung erarbeiten zu können. Thomas Hampson hat mit dem alternden und am Ende resignierenden König eine neue Glanzrolle gefunden. Mit totaler Identifikation der Partie macht er das Schicksal dieses anderen König Marke fühlbar. Wie er mit seinem kraftvollen Bariton Glück und Verzweiflung, Trauer und Verzweiflung auszudrücken vermag, ist einfach großartig. Wenn er am Ende dem Leben entsagt, als er erkennt, dass seine Herrschaft und die Tafelrunde dem Untergang geweiht sind, hinterlässt das schon einen bleibenden Eindruck. Großartig auch Stanislas de Barbeyrac mit seinem schönen, lyrischen Tenor als Lyonnel (in dieser Partie sind die beiden treuen Begleiter Kurwenal und Brangäne in einer Person zusammengefasst). Alexandre Duhamel ergänzte als böser Mordred (das Äquivalent zu Melot). Der musikalische Triumph wurde gekrönt von der großartigen Leistung des Orchesters der Pariser Oper unter ihrem Chefdirigenten Philippe Jordan. Er muss „Le Roi Arthus“ wohl schon als Kind kennengelernt haben (sein Vater hat ja 1985 dieses Werk für die Schallplattenfirma Erato eingespielt; in dieser Referenzaufnahme singen u.a. Teresa Zylis-Gara, Gösta Winbergh und Gino Quilico die Hauptrollen). Philippe Jordan ließ die Musik atmen und sich organisch entwickeln. Er schwelgte geradezu in dem betörenden Klangrausch, den das Orchester entfachte, nahm jedoch stets Rücksicht auf die Sänger. Trotz der dicken Orchestrierung deckte er die Sänger nie zu. Heutzutage ist das leider eine Seltenheit bei großen Dirigenten.
Zu Recht hat er dafür am Schluss einen großen persönlichen Erfolg errungen. Sophie Koch startete 2007 ihren Wechsel ins dramatischere Fach mit einer sehr eindrucksvollen Leistung als Margared in „Le Roi d’Ys“ von Édouard Lalo am Théâtre du Capitole in Toulouse. Seither hat sie auch weitere dramatische Partien in ihr Repertoire aufgenommen: die Brangäne, die Venus die Fricka und die Waltraute. Die Genièvre in „Le Roi Arthus“ kommt nun gerade im richtigen Moment. Die Rolle liegt ihr so gut in der Kehle als wäre diese Partie extra für sie geschrieben worden, aber leider wurde sie von der Regie total im Stich gelassen. Hoffentlich wird ihr noch einmal die Gelegenheit geboten diese Partie in einer anderen Inszenierung erarbeiten zu können. Thomas Hampson hat mit dem alternden und am Ende resignierenden König eine neue Glanzrolle gefunden. Mit totaler Identifikation der Partie macht er das Schicksal dieses anderen König Marke fühlbar. Wie er mit seinem kraftvollen Bariton Glück und Verzweiflung, Trauer und Verzweiflung auszudrücken vermag, ist einfach großartig. Wenn er am Ende dem Leben entsagt, als er erkennt, dass seine Herrschaft und die Tafelrunde dem Untergang geweiht sind, hinterlässt das schon einen bleibenden Eindruck. Großartig auch Stanislas de Barbeyrac mit seinem schönen, lyrischen Tenor als Lyonnel (in dieser Partie sind die beiden treuen Begleiter Kurwenal und Brangäne in einer Person zusammengefasst). Alexandre Duhamel ergänzte als böser Mordred (das Äquivalent zu Melot). Der musikalische Triumph wurde gekrönt von der großartigen Leistung des Orchesters der Pariser Oper unter ihrem Chefdirigenten Philippe Jordan. Er muss „Le Roi Arthus“ wohl schon als Kind kennengelernt haben (sein Vater hat ja 1985 dieses Werk für die Schallplattenfirma Erato eingespielt; in dieser Referenzaufnahme singen u.a. Teresa Zylis-Gara, Gösta Winbergh und Gino Quilico die Hauptrollen). Philippe Jordan ließ die Musik atmen und sich organisch entwickeln. Er schwelgte geradezu in dem betörenden Klangrausch, den das Orchester entfachte, nahm jedoch stets Rücksicht auf die Sänger. Trotz der dicken Orchestrierung deckte er die Sänger nie zu. Heutzutage ist das leider eine Seltenheit bei großen Dirigenten.

Ein musikalisches Ereignis, dem leider ein szenisches Desaster den Weg zum uneingeschränkten Triumph versperrte. Der Regisseur Graham Vick hat die Geschichte auf ein banales Dreiecksdrama im Wohnzimmer-Milieu reduziert. Ein kleines Fertigteilhäuschen, das zu Beginn zusammengesetzt wird, in einer knallgrünen Hügellandschaft mit einem mittelalterlichen Turm im Hintergrund, ein scheußliches grellrotes Kunstledersofa (das im Laufe des Abends abgefackelt wird), ein kleinbürgerlicher Vorgarten (nur die Gartenzwerge fehlen noch). In diesem Ambiente lässt der Bühnenbildner Paul Brown die Ritter der Tafelrunde ihren Sieg über die Sachsen feiern. Mit nur wenigen Veränderungen bleibt das Bühnenbild fast den ganzen Abend lang gleich. Die Kostüme (ebenfalls von Paul Brown), größtenteils dem Schlabberlook der Gegenwart frönend, waren von einer ausgesprochenen Hässlichkeit. Nachdem die Jungs von heute nicht wissen, was man mit so riesigen Schwertern anfangen soll, die sie anfangs mit sich herumschleppen, stoßen sie die Schwerter rund um das Haus in den Boden und sparen sich damit einen Zaun zu errichten. Der Zauberer Merlin (Peter Sidhom) sollte eigentlich König Arthus in einem Apfelbaum erscheinen. Hier sitzt Merlin von Beginn des Aktes an zusammengekauert neben dem Herd und fängt irgendwann zu singen an. Banaler geht’s ja wohl nicht mehr. Jedes weitere Wort über diese „Inszenierung“ verlieren zu wollen wäre nur Verschwendung.

Szenische Verhunzungen sind wir ja leider schon gewöhnt, aber gerade bei einem Werk, das wahrscheinlich mehr als 99% der Besucher noch nie zuvor gesehen haben, könnte man von einem Regisseur schon so etwas wie Werktreue verlangen. Das Resultat war, dass in den beiden Pausen ein wahrer Exodus von großen Teilen des Publikums zu registrieren war. Und wahrscheinlich halten jetzt viele vorzeitig Geflüchtete das Werk von Chausson für schwach. Das ist nun einzig und allein auf das unverantwortliche Verhalten des Regisseurs zurückzuführen. So konnte sich dieses Meisterwerk leider einem Großteil des Publikums nicht erschließen. Dieses Werk hätte bei der Pariser Erstaufführung wahrlich eine bessere szenische Umsetzung verdient.
1965 wurde ein kleines schwarzes Notizbuch entdeckt, in dem Ernest Chausson seine zukünftigen Opernpläne notierte. Zehn Werke der Weltliteratur standen auf der Liste, darunter Shakespeares „Macbeth“ und eine „Turandot“-Oper (lange vor den berühmten Vertonungen von Puccini und Busoni). Man darf gar nicht daran denken, welche Werke uns Ernest Chausson vielleicht noch hätte schenken können, wäre er nicht 1899 im Alter von nur 44 Jahren an den Folgen eines Fahrradunfalls gestorben.
Nachdem nun „Le Roi Artus“ wieder die Bühne erobert hat, hoffen wir, dass wir die anderen Opern-Ritter in seinem Gefolge auch bald kennen lernen werden. Da gäbe es zum Beispiel den legendären „Fervaal“ von Vincent d’Indy, „Le Roi d’Ys“ von Lalo oder „La Légende de Tristan“ von Tournemire.
Waldemar Kamer und Walter Nowotny
Bilder (c) OdP
OPERNFREUND PLATTEN TIPP